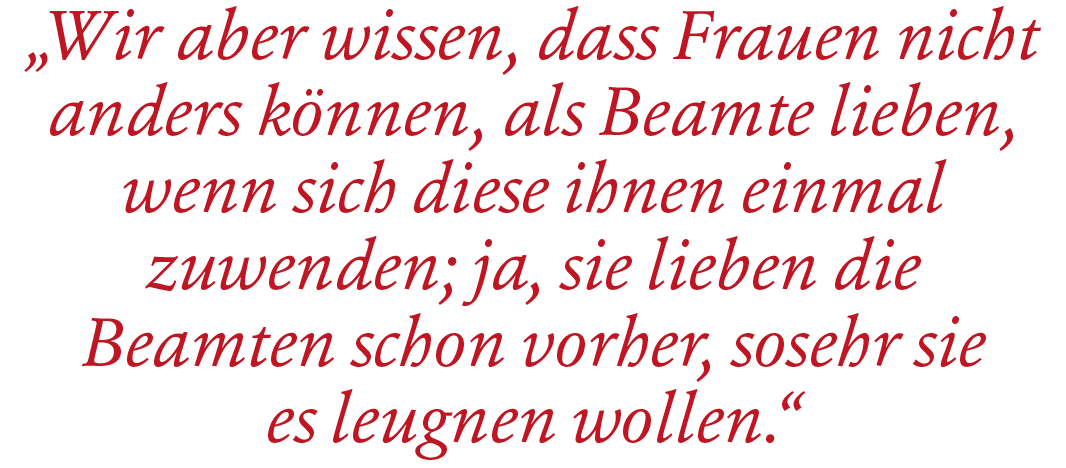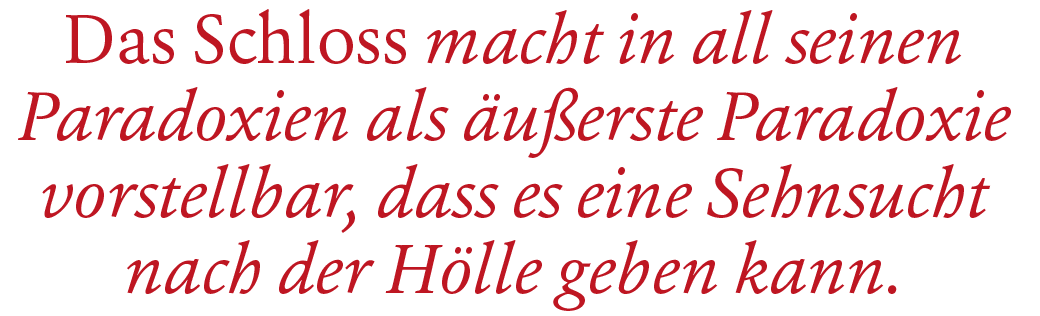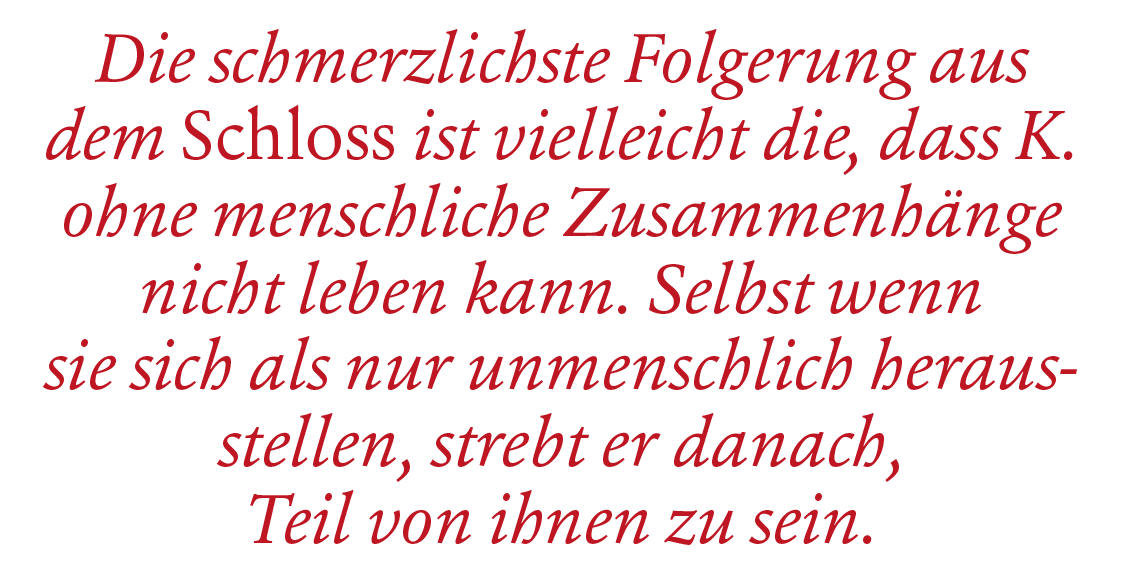„Manchmal ist mir wie einem Gladiator im Training,
er weiß nicht, was man mit ihm beabsichtigt,
aber nach dem Training zu schließen, das man ihm auferlegt,
wird es vielleicht ein großer Kampf werden vor ganz Rom.“
(Aus einem Brief Franz Kafkas an Max Brod)
Das Schloss von Franz Kafka zu lesen oder überhaupt etwas von diesem Autor zu lesen, als gäbe es die ganze Rezeptionsgeschichte nicht, kann bald hundert Jahre nach seinem Tod noch dem naivsten Leser kaum gelingen. Zu stark ist die Definitionskraft des Werkes, zu stark auch die Vorstellung dessen, was ein Schriftsteller ist oder was er sein könnte, von seiner Person geprägt, zumindest ein bestimmter Typus Schriftsteller, als dass nicht jeder nur ein bisschen Interessierte in irgendeiner Form davon gehört hätte. In Kafkas eigenen Worten ist dieser Typus Schriftsteller „der Sündenbock der Menschheit, er erlaubt den Menschen, eine Sünde schuldlos zu genießen, fast schuldlos“.
Neben dem vielstrapazierten Begriff „kafkaesk“ müsste es längst ein nach Kafka benanntes Verfahren der Herstellung von Paradoxien geben. Es müsste eine Kafkasche Zahl wie die Eulersche Zahl oder die Zahl Pi geben, die den ganz eigenen Brechungswinkel bestimmt, unter dem sein Blick die Wirklichkeit verrückt, sowie einen eigenen Kafkaschen Gefühls- und Seinszustand, der diese Mischung aus Höflichkeit, Scham, Pedanterie, Zwanghaftigkeit und Zurücknahme der eigenen Person bis zur Selbstauslöschung bei gleichzeitiger unbedingter Integrität im Umgang mit sich und der Welt beschreibt. Selbst das paradoxe Ideal des nicht schreibenden oder vielmehr nicht publizierenden Autors – denn „ein nicht schreibender Schriftsteller ist allerdings ein den Irrsinn herausforderndes Unding“ – als höchste Existenzstufe jedes Schreibenden mag immer schon eine romantische Vorstellung gewesen sein, ist aber am Ende am stärksten von Kafka besetzt.
Kafka ist der wohl am meisten heiliggesprochene Autor der Literaturgeschichte und gleichzeitig einer der wenigen, die alle Heiligsprechungen unbeschadet überstanden haben. Kaum eine andere Autorenbiografie, an der sich die ebenso heilende wie unheilvolle Wechselwirkung zwischen Leben und Kunst drastischer aufzeigen ließe, die Ambivalenz zwischen einer unaufhörlichen Sehnsucht nach dem Leben und der ständigen Angst davor. Man kann Kafka lesen mit dem Wunsch, ihn vor sich selbst in Schutz zu nehmen, vor dem Prozess, den er gegen sich führt, vor dem Urteil und dem Schuldspruch eines nicht gelebten Lebens, den er am Ende gegen sich erhebt, als würde ihm nicht genau die Vorstellung von einem gelebten Leben jedesmal den Atem rauben und das Leben verunmöglichen, weil sie ihm das Schreiben verunmöglicht. Und man kann Kafka nicht lesen, ohne ihn vor der allzu schnellen Inanspruchnahme durch all die Mühseligen und Beladenen, all die Missverstandenen dieser Welt in Schutz nehmen zu wollen, die in ihm ihren Sprecher gefunden zu haben glauben und seinen Fall zu ihrem machen und sich damit für alle eigenen Unzulänglichkeiten exkulpieren. Kafka, der in seinem Lebenswillen, in seinem Lebenwollen frustrierte Sohn, Kafka und seine nachgeborenen Söhne dominanter Väter, Kafka, der „Heiratsschwindler“ wider Willen, Kafka und die Frauen, Kafka und seine nachgeborenen Kafka-Versteher und Kafka-Frauen-Versteher. So viel ungelebtes Leben wie ihm manchmal – wieder in einer paradoxen Fügung – als höhere Seinsform eines wirklich und ernsthaft und, ja, rein gelebten Lebens aufgebürdet wird, kann niemand, kann nicht einmal er tragen, sodass man sich unwillkürlich dabei ertappt, Äußerungen über unhinterfragte Momente, Äußerungen des Glücks in seinem Schreiben gegen die Gemeinde seiner Bewunderer in Stellung zu bringen, die ihm am liebsten noch das letzte bisschen Leben rauben würden. Es gibt nicht viele solche Stellen, aber es gibt sie, es gibt sie in den Briefen, und es gibt sie in den Tagebüchern, Bilder eines rudernden, eines Schlitten fahrenden, eines durch den Schnee spazierenden, ja, sogar eines Champagner trinkenden Kafka als wenn auch nur schwache Zeugnisse gegen die ewige Ikone des Duldens und Leidens: „Bin schon gerodelt, werde es vielleicht sogar mit den Skiern versuchen.“
Am Ende ist es ohnehin nur mehr der Schmerz des „Zu spät“ und die traurige Sehnsucht eines zum Gotterbarmen Vereinzelten, der nach dem Leben dürstet. „Die Einsamkeit, die mir zum größten Teil seit jeher aufgezwungen war, zum Teil von mir gesucht wurde – doch was war auch dies anderes als Zwang –, wird jetzt ganz unzweideutig und geht auf das Äußerste“, notiert der noch nicht Vierzigjährige am 16. Januar 1922 etwa zur Zeit des Beginns der Niederschrift von Das Schloss in sein Tagebuch – und weiter: „die Jagd geht durch mich und zerreißt mich.“ Fast zehn Jahre davor hatte es sich in einer „Zusammenstellung alles dessen, was für und gegen meine Heirat spricht“ noch angehört wie ein äußerst selbstbewusstes, fast zum Heroischen neigendes Programm: „Ich muss viel allein sein. Was ich geleistet habe, ist nur ein Erfolg des Alleinseins.“ Und nur drei Tage darauf, am 19. Januar, folgt die für einen, der sich ganz und gar seiner Kunst verschrieben hat, erschreckende Bemerkung: „Sisyphus war ein Junggeselle“, und noch einmal fünf Tage später das Fazit: „Mein Leben ist das Zögern vor der Geburt.“ Danach die Sehnsucht, die Mädchen, die Blicke, zuerst in einer Ausstellung am 7. April: „Märchenprinzessin … Nacktes Mädchen … Sitzendes Bauernmädchen“, dann im wirklichen Leben: „Gestern Makkabimädchen in der ‚Selbstwehr‘-Redaktion“ am 27. April, „Das kleine, schmutzige, bloßfüßige laufende Mädchen im Hemdkleidchen mit wehendem Haar“ am 20. Mai, „Das Mädchen in der Stalltür des verfallenen Hofes … mit ihren starken Brüsten, unschuldig-aufmerksamer Tierblick“ am 27. Juli, mögliche Freundinnen vielleicht, die nie gehabten Töchter – und keine zwei Jahre mehr zu leben: „Mein Leben lang bin ich gestorben und nun werde ich wirklich sterben.“
Die Vorstellung von Franz Kafka als Fünfzigjährigem, wenn er da noch gelebt hätte, die Vorstellung von Franz Kafka als gefeiertem Autor der Romane Amerika, Der Prozess und Das Schloss im Jahre 1933 (so er sich schließlich doch entschieden hätte, die Manuskripte fertigzustellen und zu Lebzeiten zu veröffentlichen), ausgewandert eher nach Palästina als nach New York, aber vielleicht auch nach New York, ein jüdischer Schriftsteller, der sich entschieden hat, fortan nicht mehr auf Deutsch zu schreiben, der größte Schriftsteller deutscher Sprache, der jetzt auf Hebräisch schreibt oder meinetwegen auf Tschechisch oder Englisch – ist eine schöne, vielleicht kitschige, aber jedenfalls gleich mehrfach sinnlose und wahrscheinlich auch obszöne Vorstellung, wenn man weiß, dass Kafkas Schwestern in den tausend Jahren des Dritten Reiches ermordet worden sind.
Das Schloss setzt ein mit der Festlegung einer Topografie und ihrer gleichzeitigen Auslöschung: „Es war spätabends, als K. ankam. Das Dorf lag in tiefem Schnee. Vom Schlossberg war nichts zu sehen, Nebel und Finsternis umgaben ihn, auch nicht der schwächste Lichtschein deutete das große Schloss an.“ Der Ort ist schnell bestimmt mit zwei Gasthäusern, dem Brückenwirt, in dem der Landvermesser in der ersten Nacht unterschlüpft, und dem Herrenhof, in dem die Beamten, Diener und Knechte des Schlosses absteigen und in dem zu nächtlicher Stunde Amtsgeschäfte oder eher wohl Verhöre geführt werden; dazu kommen eine Schule und ein paar Innenräume – und schon beginnt das paradoxe, perverse, das schikanöse Spiel für den zugereisten Landvermesser, der ins Schloss will, um sich in seinem Auftrag bestätigen zu lassen, und der zwar einen Brief aus dem Schloss erhält, bald aber auch beschieden bekommt, dass kein Landvermesser erwartet wird.
Es ist eine abweisende, hinterhältige, sich belauernde Dorfgesellschaft, in die er geraten ist, und Kafka findet immer neue Wege, alle Hoffnungen, die der Landvermesser hat, vom Schloss wirklich gehört zu werden, zunichte zu machen. Das Perfide daran ist, dass jede Hoffnung in ihrer Enttäuschung eine neue, kleinere Hoffnung gebiert, jede ausgeschlossene Möglichkeit eine neue, kleinere Möglichkeit, ans Ziel zu gelangen, ja, erlöst zu werden, nur um am Ende, wenn alles durchgespielt ist und wenn vermeintlich alle Eventualitäten bedacht sind und dann doch immer neue Eventualitäten gefunden werden, die noch zu bedenken wären, den Beweis der Unmöglichkeit umso deutlicher zu führen. Es wird alles durchdekliniert, konjugiert, iteriert und permutiert, was die Gesetze der Logik an Argumenten für eine Sache zulassen – und über die Gesetze der Logik hinaus. „Die Logik ist zwar unerschütterlich“, heißt es schon ganz am Ende von Der Prozess, „aber einem Menschen, der leben will, widersteht sie nicht.“
Also gilt für Kafka das tertium non datur nicht, nach dem immer eine Aussage oder ihr Gegenteil wahr ist und jede weitere Möglichkeit ausgeschlossen werden kann. Bei ihm gibt es zu zwei sich widersprechenden Möglichkeiten immer noch eine dritte, vierte und fünfte Möglichkeit, man muss nur bis in die Fußnoten des Lebens vordringen, nur bis zum Kleingedruckten der menschlichen Beziehungen, wo noch ein Funken Hoffnung aufflackert, der dann umso gründlicher ausgetreten wird. Wie wenig es einen Landvermesser, der von außen kommt, in dieser Welt braucht, wird K. gleich im ersten Kapitel des Romans verdeutlicht: „Gastfreundlichkeit ist bei uns nicht Sitte, wir brauchen keine Gäste“, und im vierten Kapitel erfährt er eine Abweisung, die in ihrer Explizitheit und Brutalität nicht eindeutiger sein könnte: „Sie sind nicht aus dem Schloss, Sie sind nicht aus dem Dorfe, Sie sind nichts. Leider aber sind Sie doch etwas, ein Fremder, einer, der überzählig und überall im Weg ist, einer, wegen dessen man immerfort Scherereien hat“, ein Unbekannter, wie man mit Beklemmung feststellt, über den andererseits immer schon alle Bescheid wissen.
Man kann sich fragen, welche Welt das ist, in die der Landvermesser K. mit seinem Initial als Namen da von seinem Autor gestoßen wird, und ob es dort überhaupt etwas zu vermessen gäbe, wenn man ihn in seinem Auftrag nur ernst nehmen würde und endlich loslegen ließe. Denn beim Lesen wird einem mehr und mehr klar, dass die Welt, in der er sich hin- und herschicken lässt, nur um am Ende weiter von seinem Ziel entfernt zu sein als am Anfang, nicht die unsrige ist. Die Welt, die Kafka erschafft, ist keine, in der physikalische Gesetze den Lauf der Dinge bestimmen. Es schneit zwar, es gibt zwar Figuren, die Menschen sind mit einer zu vermutenden Biologie ausgestattet, aber darüber hinaus sind es andere Gesetze, ist es auch nicht Psychologie, ist es nicht Soziologie, es sind mathematisch-logische Gesetze, die diese Welt mit ihren Möglichkeiten und Unmöglichkeiten regieren und ihre Schönheit ausmachen, ihre Klarheit bei aller Düsternis, ihre erschreckende Klarheit oft.
„Logic’s hell!“ erinnert sich Ludwig Wittgenstein in seinen Vermischten Bemerkungen an einen von Bertrand Russell in ihren Gesprächen immer wieder getätigten Ausspruch, und er fährt fort: „Der Hauptgrund dieser Empfindung war, glaube ich, das Faktum: daß jede neue Erscheinung der Sprache, an die man nachträglich denken mochte, die frühere Erklärung als unbrauchbar erweisen könnte“ – ein Satz, der sich gut als Motto für alle poetologischen Überlegungen zum Schloss machen würde. Ja, in Kafkas Welt könnte es einen Himmel geben, es könnte eine Hölle geben, Himmel und Hölle könnten ein und dasselbe sein, aber was es jedenfalls gibt, wenn man sich schon dieser Termini bedient, ist ein ewiges Fegefeuer des Hingehaltenwerdens, Hoffnungschöpfens und wieder Hingehaltenwerdens.
Fragt man sich, was neben dem Schloss und dem Dorf in dieser Welt noch existiert, fragt man sich, wie die Verbindungswege aussehen, wie das Umland, das zu vermessen wäre, fragt man sich, ob es eine äußere Welt, ob es Wege hinaus überhaupt gibt – schließlich ist K. ja von irgendwoher gekommen –, muss man sich, wenn man Kafka konsequent liest, mit dem beunruhigenden Gedanken auseinandersetzen, dass die Welt rundherum, jedenfalls die Welt, wie wir sie kennen, verschwunden ist, umso mehr wegerzählt, je mehr Kafka seine eigene Welt herbeierzählt hat, um dann auch ihr mit Verve zu Leibe zu rücken und sie in ihrer Existenz zu erschüttern. Es gibt in seinem Schreiben – das gilt für den Zwillingsroman Der Prozess ebenso, weniger für Amerika – keine oder jedenfalls kaum deutlich erkennbare Realitätssplitter aus der sogenannten wirklichen Welt wie bei den meisten Autoren der Weltliteratur. Alles ist bei Kafka Sprache, alles ist bei Kafka Logik und existiert ohne Kafkas Sprache und Kafkas Logik nicht, weshalb das Fremdeste an diesem sehr fremden, von einem Fremden und mit unserer Welt wie ein Kind fremdelnden Autor geschriebenen Roman ausgerechnet die beiden realen Ortsbezeichnungen „Südfrankreich“ und „Spanien“ sind, die darin vorkommen. Mit ihnen verbinden sich Fluchtfantasien, Auswanderungsträume aus der Welt des Schlosses, die aber sogleich wieder ausgelöscht werden: „‚Auswandern kann ich nicht‘, sagte K., ‚ich bin hierhergekommen, um hier zu bleiben. Ich werde hierbleiben.‘“
Das Schloss, das Dorf und rundherum eine unendlich weite weiße Fläche, in der ein unaufhörlich fallender Schnee alle Konturen auslöscht, ein schwarzes Loch, das die letzten Lichter verschluckt hat? Wie soll man sich das ausmalen? Es gibt Autoren, bei denen man den Eindruck gewinnen kann, sie stellten sich den ganzen Raum vor, wenn sie einen Tisch beschreiben und einen Stuhl, auf dem jemand sitzt, sie wüssten genau, wo die Tür ist, wo das Fenster, wo ein Bild an der Wand, selbst wenn sie das alles nicht erwähnen; es gibt andere Autoren, die nur an den Tisch und den Stuhl denken, wenn sie von einem Tisch und einem Stuhl schreiben, und keine Vorstellung davon haben und auch keine Vorstellung brauchen, wo eine Tür sein könnte, wo ein Fenster und wo an der Wand ein Bild, weil sie darauf vertrauen, dass sich ein Leser das Zimmer nach Bedarf schon selbst möblieren wird – und es gibt Kafka, bei dem man das Gefühl hat, dass da weder eine Tür noch ein Fenster, noch ein Bild an der Wand ist, solange er nicht explizit davon gesprochen hat. Wenn einem nicht früher schon aufgeht, mit welcher Voraussetzungslosigkeit sich dieser Roman seine Welt und die Gesetze, nach denen sie funktioniert, erst erschafft, muss es spätestens bei der Szene sein, in der K. auf seine beiden Gehilfen trifft, die er für den Tag nach seiner Ankunft erwartet – und da hat gerade erst das zweite Kapitel begonnen.
Natürlich sollte er sie kennen, als seine früheren Mitarbeiter, aber sie stellen sich als die für ihn Fremden heraus, die er vorher vom Schloss hat kommen sehen und die weder Messinstrumente dabei haben noch etwas von Landvermessung verstehen, wie sie freimütig bekennen. Damit ist endgültig ein Schwenk ins Phantastische vollzogen und ein deutlicher Hinweis gegeben, dass es die Welt, aus der sie kommen sollten, entweder gar nicht gibt oder dass sie keine Rolle spielt, weil ihre Welt die des Schlosses ist. K. hat fortan mit der Anwesenheit der beiden zu leben, die immer schon da sind oder ebenso erwartet wie unerwartet auftauchen, mit ihrer kompromittierenden Nähe und ihrer vulgären Aufdringlichkeit. Im Wortsinn sind sie natürlich sowieso alles andere als Gehilfen, eher Beobachter, vom Schloss gestellte und dirigierte Aufpasser, Spitzel, eine ständige Warnung und Drohung. Wenn man den Prozess gelesen hat, denkt man unweigerlich auch an die beiden Gehröcke und Zylinder tragenden Herren, die Josef K. am Ende jenes Romans abholen kommen und in einem Steinbruch abstechen wie ein Stück Vieh, in ihren Umgangsformen vielleicht feiner als die beiden Gehilfen, in ihrer Effektivität als Henker aber umso grausamer, und beginnt um das Leben des Landvermessers K. im Schloss zu fürchten. Denn auch für ihn hat längst der Satz Gültigkeit, der den Prozess beschließt: „es war, als sollte die Scham ihn überleben.“
Der Graf Westwest, der Herrscher über das Schloss, trägt seinen Namen sicher nicht zufällig, vielleicht gerade weil die Kafkaschen „Landschaften“ als Himmelsrichtung eher den Osten evozieren, selbst in Amerika, selbst in dem dort mit „Das Naturtheater von Oklahoma“ überschriebenen Kapitel. Es ist aber nicht er, nicht der Graf, der im Schloss die letzte Macht und letzte Unerreichbarkeit repräsentiert, sondern paradoxerweise, was in Kafkas Welt nur logischerweise heißt, ein Beamter des Schlosses, Klamm mit Namen, der als Vorstand der X. Kanzlei eingeführt wird – nicht mächtig, möchte man meinen, und doch mächtig genau dadurch, weil neben ihm, hinter ihm und über ihm noch andere stehen müssen und man ahnt, dass selbst von ihm gehört zu werden, was K. jedoch niemals gelingt, noch gar nichts bedeuten würde. Er kommt ihm nie so nahe wie ganz am Anfang, wo ihn im Herrenhof das Schankmädchen Frieda, die Geliebte Klamms, den im Nebenzimmer schlafenden Klamm durch ein Guckloch betrachten lässt, und später noch einmal, als er glaubt, dass er seine Abreise in einer Kutsche nur um ein Haar versäumt hat, und nicht weiß, dass dieses Um-ein-Haar-Versäumen das System ist. Ein Augenblick der Unaufmerksamkeit, und man kann darauf schwören, dass genau in diesem Augenblick das Entscheidende geschieht, wiewohl gleichzeitig klar ist, dass es sonst vielleicht gar nicht geschehen wäre. Der Beobachter beeinflusst auch in dieser Welt das Beobachtete, genauso wie der Nicht-Beobachter ein Ermöglicher ist, der fürchten muss, dass sich die Welt, während er ihr den Rücken zukehrt, zu seinem Nachteil weiterdreht.
Der Roman ist schon weit fortgeschritten, als der Satz „Es ist hier die Redensart, vielleicht kennst du sie: Amtliche Entscheidungen sind scheu wie junge Mädchen“ fällt, worauf K. erwidert, das sei eine gute Beobachtung. Da hat man als Leser längst schon allen Grund zuzustimmen, so sehr ist man durch diesen Eventualitäten-Parcours geschleust worden und hat gleichzeitig selbst die Beobachtung gemacht, dass in dieser Welt ausgerechnet die jungen Mädchen nicht scheu wie junge Mädchen sind. Wo sonst fast nichts klar ist, ohne dass noch dies und jenes und nach diesem und jenem immer noch Weiteres bedacht werden muss, geht es zwischen den Geschlechtern mit einer Direktheit zur Sache, die einen nur verblüffen kann, sind die auftretenden Frauen oft nicht mehr als Verschubobjekte in dem Macht-, Unterdrückungs- und Sich-gegenseitig-eins-Auswischens-Spiel der Männer, Figuren in einer imaginären Schachpartie, in der nur Bäuerinnen verschoben werden.
Es muss dem im realen Leben im Umgang mit Frauen alles andere als forschen Beamten Kafka einen grotesken Spaß gemacht haben, sich ausgerechnet im Beamten mit seiner Beamtenvollmacht der sukzessiven Verhinderung und Verunmöglichung, der nach jedem Klischee am wenigsten erotischen Erscheinungsform des Menschen, das höchste Objekt weiblicher Begierde auszumalen. Jedenfalls ist es böse Ironie, Sätze zu schreiben wie die folgenden und sie auch noch einer Frau in den Mund zu legen, und sie können nur in einem Roman wie Das Schloss überhaupt ernst genommen werden – als Schilderung einer irrealen und deshalb nach den Gesetzen Kafkas umso realeren Totalität der Verfügbarkeit: „Das Verhältnis der Frauen zu den Beamten ist … sehr schwer oder vielmehr immer sehr leicht zu beurteilen. Hier fehlt es an Liebe nie. Unglückliche Beamtenliebe gibt es nicht. Es ist in dieser Hinsicht kein Lob, wenn man von einem Mädchen sagt …, dass sie sich dem Beamten nur deshalb hingegeben hat, weil sie ihn liebte“, oder: „Wir aber wissen, dass Frauen nicht anders können, als Beamte lieben, wenn sich diese ihnen einmal zuwenden; ja, sie lieben die Beamten schon vorher, sosehr sie es leugnen wollen.“
Belege, dass im Umgang der Geschlechter fundamental etwas nicht stimmt, gibt es viele. Die Geschichte des Schankmädchens Frieda könnte eine eigene Binnengeschichte sein, Geliebte Klamms, wie sie selbst stolz kundtut, Geliebte K.s, obwohl sie für ihn als Geliebte eines Beamten unerreichbar sein sollte, schließlich auch noch Geliebte seines Gehilfen, dem an ihr nicht mehr liegt als die eigene Aufwertung als letztes Glied in dieser Reihe: eine ganze Serie von immer neuen Verlust- und Versehrungsgeschäften, auf ihrem Rücken ausgetragen. Wie schnell ohne jedes Hin und Her, ohne jede Anbahnung von Liebe gesprochen wird, von ohnmächtiger Liebe gar, kaum dass Frieda und K. sich kennengelernt haben, als wäre genau dieses Wort das einzige, das keiner weiteren Klärung bedürfte, wo sonst alles einer weiteren Klärung bedarf, ist an Direktheit kaum zu überbieten. Wie schnell es zwischen den beiden zum Äußersten kommt, zu einer derben Sexszene auf dem Boden des Ausschanks im Herrenhof, während der ahnungslose Klamm aus dem Nebenzimmer nach Frieda ruft, wirkt ebenso hemmungslos wie vom Autor hemmungslos inszeniert.
Aber nicht nur Frieda, auch die anderen Frauen werden in der Regel mit ihrem ersten Auftreten oder sonst jedenfalls bald danach erotisiert und sexualisiert: die Brückenwirtin, die auch einmal eine Geliebte Klamms gewesen sein soll und immer noch für ihn verfügbar ist, sich immer noch von ihm „rufen“ lassen wollte, wenn er sie denn rufen würde; Pepi, die Nachfolgerin Friedas im Ausschank des Herrenhofs, von der es gleich heißt: „Niemals hätte K. Pepi angerührt“, was man nicht aufs Wort glauben sollte, eher schon, was danach folgt: „Aber doch musste er jetzt für ein Weilchen seine Augen bedecken, so gierig sah er sie an“; und dann auch noch Olga und Amalia, die beiden Schwestern von Barnabas, dem Boten des Schlosses. Olga wird im Herrenhof den Bauern und Knechten zu deren Verlustierung vorgeworfen wie ein Stück Fleisch – Frieda treibt sie zusammen mit ihnen, eine Peitsche in der Hand wie eine Domina, in den Stall –, und nur in der Person von Amalia gibt es Widerstand gegen dieses erotische Zwangs- und Instanterfüllungssystem: Sie hat sich in der Vergangenheit den Avancen eines Beamten widersetzt, was wohl das Schlimmste überhaupt ist, das sich eine Frau in dieser Welt herausnehmen kann, und ihre Familie ist seither geächtet, ja, steht unter einem Fluch. Handelte es sich um einen realistischen Roman, könnte man über all das den Kopf schütteln, aber auch in einem phantastischen Roman wie Das Schloss ist es das Grauen.
Indessen bringt das konsequente Durchdeklinieren von immer neuen Alternativen beziehungsweise das Ausdenken und Erfinden von solchen, wenn es längst keine mehr zu geben scheint, nicht nur K. an die Grenze seiner Möglichkeiten, sondern den Roman selbst. Wenn es etwa von Klamm heißt: „Er soll ganz anders aussehen, wenn er ins Dorf kommt, und anders, wenn er es verlässt, anders, ehe er Bier getrunken hat, anders nachher, anders im Wachen, anders im Schlafen, anders allein, anders im Gespräch und, was hiernach verständlich ist, fast grundverschieden oben im Schloss“, kann man bezweifeln, ob Klamm überhaupt existiert und in der Folge das Schloss. Gleichzeitig liest sich das wie ein Anschlag auf das Erzählen und auf dessen Freiheiten. Denn nur einen Schritt weiter, und es droht die Beliebigkeit eines automatischen Iterations-Verfahrens, dem jede Situation unterworfen wird: so oder so oder vielleicht anders oder vielleicht doch nicht, vielleicht doch so.
Die Frage, ob Das Schloss ein gelungener Roman ist oder bei seinem immer weiter iterierten „Es war freilich noch bei weitem nicht genug erklärt und konnte sich schließlich noch ins Gegenteil wenden“, wie es an einer Stelle heißt, ein gelungener Roman geworden wäre, wenn Kafka ihn beendet hätte, nimmt ihm nichts von seiner Größe. Ich spreche nicht von dem, was gemeinhin als Scheitern auf hohem Niveau bezeichnet wird, das hohe Niveau steht außer Frage, ich spreche vom Scheitern des Helden angesichts eines übermächtigen Systems, das sich ihm immer mehr entzieht, je mehr er seinen Platz darin zu finden trachtet, und das im Roman seine Abbildung finden muss. K.s Anstrengungen, ins Zentrum zu gelangen, haben immer neue Abstoßungen vom Zentrum weg in immer größeren Radien zur Folge – Verausgabung als Prinzip also, nicht Konzentration, was konsequent ist, für einen Roman aber eine schwierige Aufgabe darstellt. Manchmal liest sich Das Schloss wie ein Versuch, das Unendliche in einer endlichen Anzahl von Schritten einzufangen, und muss in diesem Anspruch natürlich eine gefährliche Grenze berühren.
Im vorletzten Kapitel des Romans, in jener Szene, in der K. im Herrenhof eine falsche Tür öffnet und so statt auf den erwarteten Sekretär Klamms auf einen ihm unbekannten Verbindungssekretär stößt, beginnt der ihm in einem langen Monolog die Probleme, die es in der Welt der Beamten und Sekretäre gibt, auseinanderzusetzen. K. hört ihm erschöpft zu, und dann heißt es: „K. hatte schon ein kleines Weilchen in einem halben Schlummer verbracht …“, und wenige Seiten weiter: „K. nickte lächelnd, er glaubte jetzt, alles genau zu verstehen; nicht deshalb, weil es ihn bekümmerte, sondern weil er nun überzeugt war, in den nächsten Augenblicken würde er völlig einschlafen … Klappere, Mühle, klappere, dachte er, du klapperst nur für mich.“ Bei einem geringeren Autor als Kafka könnte man einen ironischen Selbstkommentar darin sehen, eine Immunisierungsstrategie, den resignierten Hilfeschrei eines Schreibenden, der sich so sehr in sein Labyrinth verstrickt hat, dass er nicht mehr weiterweiß, weder einen Ausweg findet, noch eine Idee hat, wie es zu sprengen wäre, und deshalb als bis zur Bewegungslosigkeit Gefesselter nur mit seinen Verstrickungen fortfahren kann, bis selbst die zum Stillstand kommen.
Laut Max Brod hatte Kafka als Ende des Romans geplant, den Landvermesser K. vor Entkräftung sterben zu lassen, wobei er vor seinem Tod noch die Botschaft aus dem Schloss bekommt, dass er immerhin die Erlaubnis habe, im Dorf zu leben, eine typische Kafkasche Volte der Vergeblichkeit, aber mir hat sich in diesen geradezu irrlichternden Versuchen, ins Schloss zu gelangen, noch ein anderes Ende aufgedrängt, vielleicht noch kafkaesker, um das Wort jetzt doch einmal zu verwenden, als das von Kafka selbst geplante. Der Landvermesser K. könnte vor seinem Tod erfahren, dass alles ein Missverständnis war, dass er der Falsche war und dass ein anderer Landvermesser im Anmarsch ist, der seine Dienste übernehmen soll; oder aber das Schloss könnte sich als das falsche herausstellen, als das nicht für ihn vorgesehene, und das für ihn vorgesehene läge ganz in der Nähe, er bräuchte nur hinzugehen, er würde dort schon erwartet, was sich dann natürlich auch als grundfalsch herausstellen müsste. Dann hätte man eine Situation wie in Kafkas Erzählung Vor dem Gesetz, vielleicht die Kafka-Situation überhaupt, wo ein Mann vom Lande zu einem Türhüter kommt und diesen vergeblich um Eintritt in das Gesetz bittet. Er setzt sich neben die Tür, und es vergehen Tage und Jahre, wie es heißt, in denen er viele Versuche unternimmt, eingelassen zu werden, bis er sich schließlich vor seinem Tod, schon alt und schwach, ein letztes Mal an den Türhüter wendet und wissen will, wieso in all den Jahren sonst niemand Einlass verlangt hat, wo doch alle nach dem Gesetz streben. „Der Türhüter erkennt, dass der Mann schon an seinem Ende ist, und, um sein vergehendes Gehör noch zu erreichen, brüllt er ihn an“, heißt es dann, und das ist, was er brüllt: „‚Hier konnte niemand sonst Einlass erhalten, denn dieser Eingang war nur für dich bestimmt. Ich gehe jetzt und schließe ihn.‘“
Das Gesetz also? Will auch der Landvermesser in das Gesetz? Und warum will er, warum sollte er überhaupt wollen, wenn sich das Gesetz, wenn sich das Schloss und alles mit dem Schloss Zusammenhängende so abweisend und grausam gegen ihn verhält? Es bedeutet keine geringe Erschütterung, beim Lesen des Romans wahrnehmen zu müssen, dass K. auf jede Zurückweisung, auf jede Demütigung mit nur umso größerer Unterwerfung unter die Gegebenheiten reagiert. Schließlich hat man den Eindruck, er würde alles tun, er würde alles hinnehmen, nur um nicht den letzten Kontakt oder auch nur die letzte Hoffnung auf Kontakt zum Schloss zu verlieren, und sei es durch den Stellvertreter eines Stellvertreters eines Stellvertreters repräsentiert. Die schmerzlichste Folgerung aus dem Schloss ist vielleicht die, dass K. ohne menschliche Zusammenhänge nicht leben kann. Selbst wenn sie sich als nur unmenschlich herausstellen, strebt er danach, Teil von ihnen zu sein, weil noch das Schlechteste unter den Menschen besser zu sein scheint, als ganz und gar außerhalb der menschlichen Gesellschaft zu stehen, ohne Anerkennung zu leben, ja, für die anderen gar nicht zu existieren. Wird Josef K. im Prozess noch von einem unmenschlichen System verfolgt, drängt K. im Schloss sich einem ebenso unmenschlichen System auf, weshalb Das Schloss auch der teuflischere dieser beiden teuflischen Romane ist. Denn es macht in all seinen Paradoxien als äußerste Paradoxie vorstellbar, dass es eine Sehnsucht nach der Hölle geben kann.
Franz Kafka, noch einmal seine eigene Stimme, schreibt im Jahre 1922, dem Jahr der Niederschrift von Das Schloss, Sätze wie die folgenden in sein Tagebuch: „Ohne Vorfahren, ohne Ehe, ohne Nachkommen, mit wilder Vorfahrens-, Ehe- und Nachkommenslust. Alle reichen mir die Hand: Vorfahren, Ehe und Nachkommen, aber zu fern für mich“ etwa, oder: „Ich bin vierzig Jahre aus Kanaan hinausgewandert“, oder: „Aber auch die Anziehungskraft meiner Welt ist groß, diejenigen, welche mich lieben, lieben mich, weil ich ‚verlassen‘ bin …“, oder: „Dankbarkeit und Rührung“ – über die Mutter – „weil ich sehe, wie sie mit einer für ihr Alter unendlichen Kraft sich bemüht, meine Beziehungslosigkeit zum Leben auszugleichen“, oder: „Zu spät wahrscheinlich und auf eigentümlichem Umweg Rückkehr zu den Menschen“ – und schließlich: „In meiner Kanzlei wird immer noch gerechnet, als finge mein Leben erst morgen an, indessen bin ich am Ende.“
Keine biografische Lesart, aber wir sehen in diesen Aufzeichnungen den Autor, wie er sich selbst sieht, und er sieht sich als ganz und gar Vereinzelten, ja, Verlassenen. Der K. aus Das Schloss ist genauso wenig Franz Kafka, wie es der Josef K. aus Der Prozess ist – dazu ist in beiden Romanen allein schon die Lust am Ästhetischen zu groß –, aber mit diesen zwei Figuren hat Kafka sich Brüder erschaffen, in denen sich seither ganze Lesergenerationen wiedererkennen, und sie in eine Welt gesetzt, in der wir gerade in ihrer Abstraktheit die unsere sehen. So sehr die Figuren aus der Vergangenheit zu kommen scheinen, so sehr sind sie in der jeweiligen Gegenwart mehr noch Sendboten der Zukunft, und deshalb haftet den Konstrukten Kafkas eine Eigenschaft an, die selbst für Klassiker nur in ganz seltenen Ausnahmefällen gilt: Sie altern nicht, haben bei all ihren Schrecken die Schönheit und Gültigkeit von mathematischen Formeln, die ewige Schönheit der Jugend. Das Wiedergängerische dieses ungleichen Zwillingspaares der beiden K. – Josef K. im Prozess und K. im Schloss – muss Kafka indes bewusst gewesen sein, genauso wie die Tatsache, dass er solche Welten nicht kreieren kann, ohne dass sie unmittelbar auf die Welt, in der er lebte, zurückwirken. „Trotzdem ich dem Hotel deutlich meinen Namen geschrieben habe, trotzdem auch sie mir zweimal schon richtig geschrieben haben, steht doch unten auf der Tafel Josef K.“, notiert er am 27. Januar 1922 in seiner Unterkunft in Spindelmühle, wohin er sich für ein paar Wochen zur Erholung und zur Arbeit, die dann die Arbeit am Schloss sein wird, zurückgezogen hat. „Soll ich sie aufklären oder soll ich mich von ihnen aufklären lassen?“