Wenn man sich nur kurz im Internet kundig zu machen versucht, kann man den Eindruck gewinnen, dass in den letzten beiden Jahren kaum ein Stadttheater ohne Flüchtlinge, die Flüchtlinge spielen, ausgekommen ist. Das Theater hat den Anspruch, eine moralische Anstalt zu sein, und trotz aller augenscheinlichen Instant-Betriebsamkeit – als gäbe es keine Kunst ohne immer wieder frisch und am besten noch blutig angeliefertes Leben – scheint die Polemik unangebracht, dass sich die Flüchtlinge, die Flüchtlinge spielen, hoffentlich nicht unmotiviert haben ausziehen und hoffentlich nicht wie am Spieß haben schreien müssen, um ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen, wie es nach dem Vorurteil derer gang und gäbe ist, die irgendwann aufgehört haben, ins Theater zu gehen und als Grund dafür angeben, dass es immer weniger Regisseure gibt, die ihr Handwerk verstehen, und immer mehr Genies. Ich habe mich bei YouTube in eine Probe hineingeklickt und es gleich wieder sein lassen, nachdem ich dabei zugesehen hatte, wie sich fünf Jugendliche bedeutungsschwer einer nach dem anderen auf den Bühnenboden fallen ließen oder wie sich andere ebenso bedeutungsschwer ängstlich hinter Stühlen versteckten, und ich mir lieber nicht vorstellen wollte, welche ihrer ebenso realen wie wahrscheinlich traumatischen Erlebnisse sie mit derartigen Unbeholfenheiten nachstellen sollten. Was sie selbst dabei dachten, konnte ich nicht wissen, aber ich würde mich nicht wundern, wenn wenigstens manche von ihnen, gerade noch in wirklicher Gefahr, solche Hampeleien, bei denen sie die Gefahr spielen mussten, als Farce empfunden hätten. Die Intention bei diesen Unternehmungen ist indessen immer eine gute, und doch bleibt ein Unbehagen, und dieses Unbehagen rührt daher, dass wohl all den Stücken, in denen Flüchtlinge Flüchtlinge spielen und die Grenze zwischen Wirklichkeit und Kunst munter einmal in die eine, einmal in die andere Richtung überqueren, der letzte Akt fehlt. Oder anders gesagt, das wirkliche Stück in diesem Austauschgeschäft zwischen Realität und Fiktion beginnt erst, wenn das Stück auf der Bühne zu Ende gespielt ist und wenn ein Flüchtling, der eben noch ein gespielter Flüchtling war, wieder ins Leben hinausgeht und von einem Augenblick auf den anderen zum Gotterbarmen echt ist.

Der französische Schriftsteller Éric Vuillard beschreibt in seinem Buch Traurigkeit der Erde das Elend des Spektakels, das Buffalo Bills Wildwest-Show in den letzten Jahren des neunzehnten und in den ersten Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts alles in allem mehr als ein Vierteljahrhundert lang darstellte. Die Indianerkriege, in denen William Cody – so der zivile Name von Buffalo Bill – selbst als Scout teilgenommen hatte, waren kaum vorbei, als er in einem riesigen Tross mit Dutzenden oder sogar Hunderten von Reitern und Pferden und Tonnen von Staffagematerial durch die Lande zog und die Indianer für Tausende von Zuschauern vor riesigen Wüsten-, Prärie- und Gebirgslandschaften auf Leinwand immer wieder ihre Niederlage und ihr Sterben zum Besten geben ließ. Die Darsteller waren echt, echte Cowboys, echte Indianer, manche sogar echte Krieger, die vor nicht so langer Zeit noch an echten Kämpfen teilgenommen hatten und die jetzt, wenn sie auf der Bühne gestorben waren, wieder aufstanden wie später überall in der westlichen Welt kleine Jungen beim Indianerspielen und ihr Sterben noch einmal spielten, oft zweimal am Tag, Tag für Tag, wochen-, monate- und schließlich jahrelang an immer neuen Orten, nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa, nachdem der ganze Haufen mit mehreren Schiffen den Atlantik überquert hatte. Man erhält eine Vorstellung von der schieren Größe und Gewaltigkeit der Aufführung, wenn man liest, dass das Kolosseum in Rom um einen Termin ansuchte, aber keinen bekam, weil es zu klein für die gigantomanischen Kampfspiele zu Pferde war. Die Verlierer der Geschichte verloren indessen immer weiter, ritten ebenso wissend wie blind in ihren unaufhaltsamen Untergang, und die johlenden Zuschauer kamen, um echte Indianer zu sehen, Wilde, die keinem mehr gefährlich werden konnten, aber für die Dauer des Schauspiels immer noch für Erregungsschauer sorgten. Eine Saison lang war der einst gefürchtete Häuptling Sitting Bull die Hauptattraktion des Spektakels, und Éric Vuillard beklagt seine Einsamkeit in der Manege: „Ladies and gentlemen, darf ich Ihnen den großen Indianerhäuptling … vorstellen …“, und wie das Publikum, ja, die Meute, die sich nur zusammengeschart hatte, um genau diese Einsamkeit zu begaffen, ihn beschimpft und bespuckt: „Hier ist es, das Unerhörte, die Rothaut, der, den man sehen wollte, das seltsame Tier, das um unsere Farmen streunte …“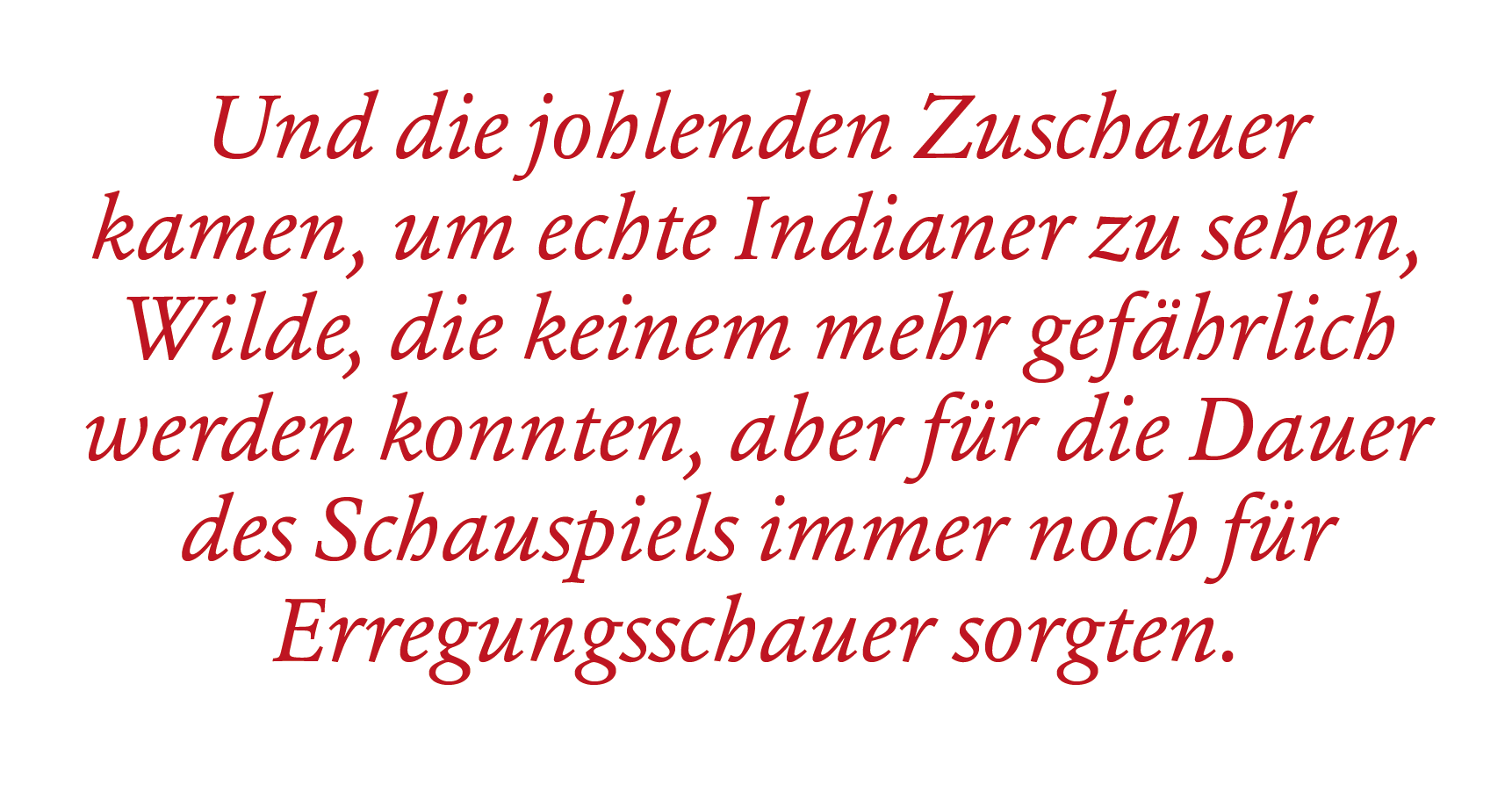 Wenn ich an dieses Bild denke, wird es in meinem Kopf überlagert von dem berühmten Bild der fünfzehnjährigen Dorothy Counts, die in Charlotte, North Carolina, auf ihrem Schulweg von einem feixenden und aggressiv lärmenden weißen Mob verfolgt wird, der sie daran hindern will, die Schule zu betreten. Es ist das Jahr 1957, und sie ist die erste Schwarze, die für die bis dahin nur für Weiße offene Harry Harding High School die Zulassung bekommen hat. Der Schriftsteller James Baldwin beschreibt, wie er das Bild an einem Zeitungskiosk in Paris sieht und im selben Moment weiß, dass seine Jahre in Frankreich vorbei sind und er nach Amerika zurückkehren muss, weil er dort gebraucht wird: „There was unutterable pride, tension, and anguish in that girl’s face as she approached the halls of learning, with history, jeering, at her back. It made me furious, it filled me with both hatred and pity. And it made me ashamed.“ Dann folgt der wunderbare Satz unhinterfragbaren Engagements, der einen wünschen lässt, man selbst wäre derjenige, von dem die Rede ist: „Some one of us should have been there with her!“
Wenn ich an dieses Bild denke, wird es in meinem Kopf überlagert von dem berühmten Bild der fünfzehnjährigen Dorothy Counts, die in Charlotte, North Carolina, auf ihrem Schulweg von einem feixenden und aggressiv lärmenden weißen Mob verfolgt wird, der sie daran hindern will, die Schule zu betreten. Es ist das Jahr 1957, und sie ist die erste Schwarze, die für die bis dahin nur für Weiße offene Harry Harding High School die Zulassung bekommen hat. Der Schriftsteller James Baldwin beschreibt, wie er das Bild an einem Zeitungskiosk in Paris sieht und im selben Moment weiß, dass seine Jahre in Frankreich vorbei sind und er nach Amerika zurückkehren muss, weil er dort gebraucht wird: „There was unutterable pride, tension, and anguish in that girl’s face as she approached the halls of learning, with history, jeering, at her back. It made me furious, it filled me with both hatred and pity. And it made me ashamed.“ Dann folgt der wunderbare Satz unhinterfragbaren Engagements, der einen wünschen lässt, man selbst wäre derjenige, von dem die Rede ist: „Some one of us should have been there with her!“
Buffalo Bill hielt sich mit seiner Mannschaft gerade in Europa auf, als es in den letzten Tagen des Jahres 1890 zu einem allerletzten Aufstand einer nur mehr kleinen Gruppe von Indianern kam, der brutal niedergeschlagen wurde und in dem Massaker von Wounded Knee in South Dakota endete. Nur zwei Wochen davor war Sitting Bull ermordet worden, und Buffalo Bill, der bei der ersten Nachricht von Unruhen sofort nach Amerika zurückgeeilt war und bei seiner Ankunft dort von dem Mord erfahren hatte, erwarb sogleich das Pferd des toten Häuptlings, ließ dessen Hütte abbauen und einschiffen und las dann auch noch die letzten Überlebenden des Massakers auf und engagierte sie für seine Wildwest Show. So konnte er gleich darauf mit zwei neuen Attraktionen aufwarten: „Sitting Bulls Tod mit seinem echten Pferd vor seiner echten Hütte, von Buffalo Bill eigenhändig erstanden“ sowie: „Ladies and gentlemen, hier sehen Sie, zum ersten Mal und mit den wahrhaftigen Teilnehmern, die berühmte Schlacht von Wounded Knee!“ Nur dass es keine Schlacht gewesen war, sondern ein Massaker, wie Éric Vuillard schreibt, veranstaltet von einem Kavallerie-Regiment und vier treffsicheren Hotchkiss-Gebirgskanonen. „Und wieder beginnt das Spektakel“, fährt er fort. „Reiter wirbeln wild durch die Manege. Staub rötet die Augen. Ein Soldat geht zu Boden, tot, dann steht er wieder auf, klopft den Staub von seiner Jacke … Die Reiter umzingeln die Indianer. Die Ränge sind zum Bersten voll, zwanzigtausend Menschen, vielleicht mehr. Plötzlich beugt sich ein Reiter akrobatisch über sein Zirkuspferd. Peng! Die Indianer eröffnen das Feuer …“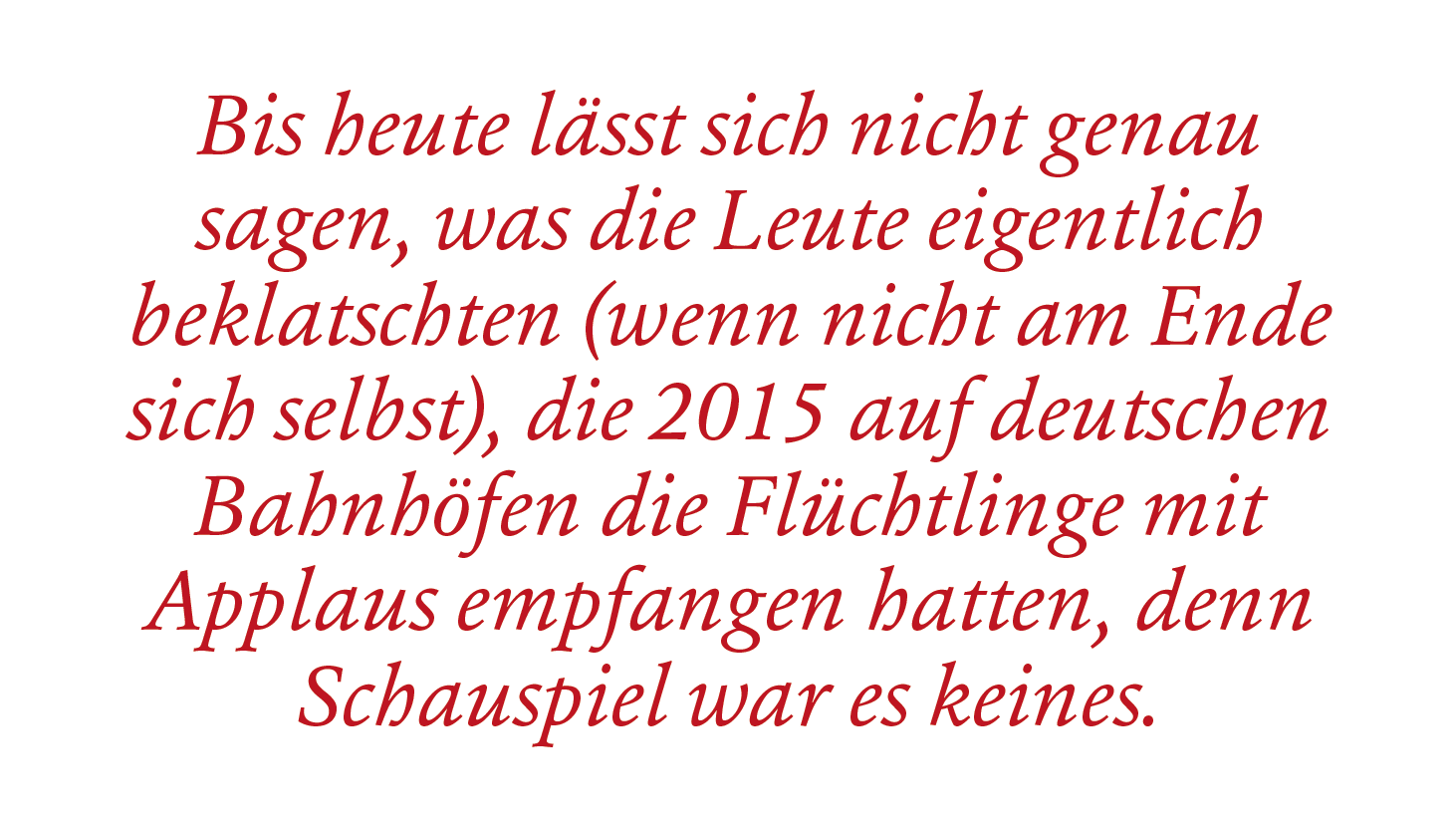 Mir scheint die Fantasie naheliegend, die echten Indianer, die schon viele hundert Male in ihren Tod geritten waren, könnten bei der tausendsten Aufführung plötzlich nicht mehr Spielzeuggewehre, sondern echte Gewehre in den Händen halten und sie zuerst gegen die echten Cowboys, die jetzt aber nur Cowboys spielten, richten und dann gegen das Publikum und das Zirkuszelt niederbrennen und in die Nacht hinausgaloppieren, in eine andere Geschichte, in der es vielleicht Gerechtigkeit für sie gab und in der sie sich nicht ad infinitum bei ihrer eigenen Auslöschung zusehen lassen mussten.
Mir scheint die Fantasie naheliegend, die echten Indianer, die schon viele hundert Male in ihren Tod geritten waren, könnten bei der tausendsten Aufführung plötzlich nicht mehr Spielzeuggewehre, sondern echte Gewehre in den Händen halten und sie zuerst gegen die echten Cowboys, die jetzt aber nur Cowboys spielten, richten und dann gegen das Publikum und das Zirkuszelt niederbrennen und in die Nacht hinausgaloppieren, in eine andere Geschichte, in der es vielleicht Gerechtigkeit für sie gab und in der sie sich nicht ad infinitum bei ihrer eigenen Auslöschung zusehen lassen mussten.
Bis heute lässt sich nicht genau sagen, was die Leute eigentlich beklatschten (wenn nicht am Ende sich selbst), die im Herbst 2015 auf deutschen Bahnhöfen die zu Tausenden eintreffenden Flüchtlinge mit Applaus empfangen hatten, denn Schauspiel war es keines – und wurde durch das Klatschen doch zu einem Schauspiel gemacht. Sie waren natürlich nicht an die Bahnsteige gekommen, um die Ärmsten zu beschimpfen oder zu bespucken, sie waren gekommen, um sie willkommen zu heißen, ihnen ihre Solidarität zu demonstrieren und ihnen zu zeigen, dass sie mit ihrem Schicksal nicht allein waren. Nun ließe sich leicht herausfinden, ob zu der Zeit irgendwo an irgendeinem Theater in Deutschland oder Österreich ein Flüchtlingsstück auf dem Programm gestanden war, vielleicht sogar Die Schutzbefohlenen von Elfriede Jelinek, die erst im Jahr davor zur Uraufführung gekommen waren, und ob zu der Zeit in dem Stück auch schon Flüchtlinge Flüchtlinge gespielt hatten – aber wie auch immer, ich formuliere keine Anklage, es ist nur die Koinzidenz, die mich interessiert, das Hin- und Herkippen zwischen Wirklichkeit und Fiktion, zwischen Leben und Kunst, und die schon angesprochene Frage, ob bei manchen der wohlmeinenden Inszenierungen nicht der letzte Akt fehlt. Denn irgendwann ist ausgespielt, und alle müssen in die Wirklichkeit zurück, oder man verlängert das Spiel und drückt einem der Flüchtlinge, die einen Flüchtling spielen, eine Pistole in die Hand, mit der er vielleicht den Regisseur erschießt – it’s fiction, stupid! – oder wenigstens droht, ihn zu erschießen, wenn er den Spuk nicht bald beendet, und lässt die anderen die Ausgänge blockieren und das Publikum so lange festhalten, bis es den wirklichen Preis bezahlt hat, den ein solches Spektakel die Zuschauer kosten könnte, die sich manchmal viel zu billig am Leid der anderen ihr Herz erwärmen und ihr Hirn erhitzen, nicht die lächerlichen zwanzig oder dreißig oder fünfzig Euro einer Theaterkarte mit garantierter Erbauung, sondern zehn, zwanzig oder dreißig Prozent ihres Einkommens – damit es wirklich weh tut und damit wirklich etwas geschieht.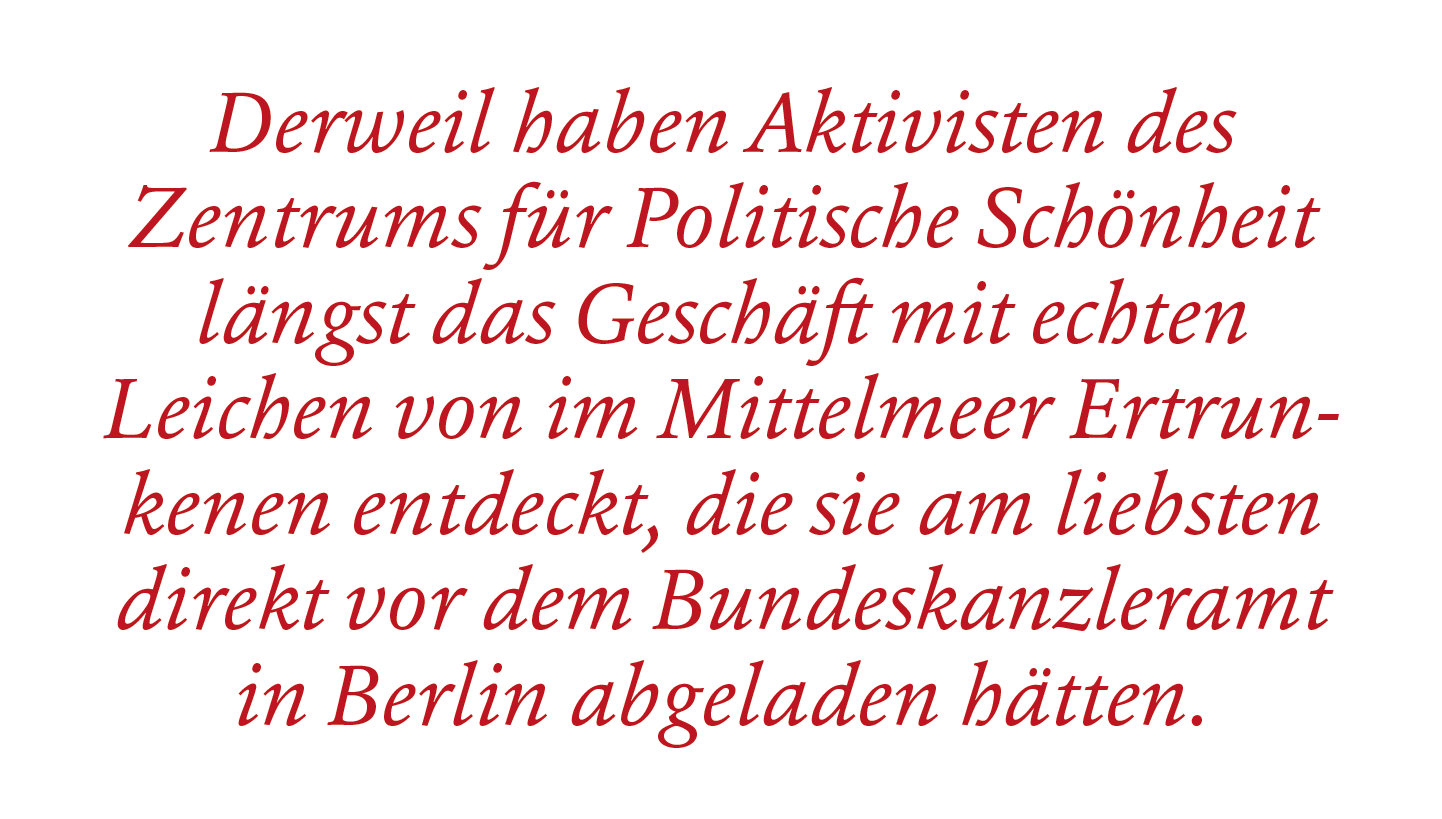 Derweil haben Aktivisten des Zentrums für Politische Schönheit längst das Geschäft mit echten Leichen von im Mittelmeer Ertrunkenen entdeckt, die sie am liebsten direkt vor dem Bundeskanzleramt in Berlin abgeladen hätten, Eskalation und Mahnung in einem, und es darf einen wundern, dass es noch keinem von den begnadeten Künstlern eingefallen ist, mit Vergnügungsschiffen vor der libyschen Küste herumzukreuzen und ihren Anhängern ein noch viel groteskeres Schauspiel zu bieten. Denn dort könnte ein zahlendes Publikum zwischen zwei Unterhaltungsprogrammpunkten an Bord von den Sonnendecks aus zusehen, wie die Schlauchboote der Flüchtlinge von der Küste ablegen, und Wetten abschließen, ob sie kentern würden oder nicht und ob im Ernstfall die Boote der Hilfsorganisationen rechtzeitig zur Stelle wären. Der Regisseur, ein Fetischist des Echt-ist-nur-was-echt-ist, könnte dann immer noch entscheiden, ob man eingreifen würde, je nachdem, ob er eher der interaktive Typ wäre oder Anhänger eines Theaters, in dem zwischen Schauspielern und Publikum eine unüberwindbare Barriere besteht, und man könnte vor dem sechsgängigen Abendessen im Viersterne-Restaurant noch die Rettungsboote klarmachen oder sich aus prinzipiellen ästhetischen Überlegungen entschließen, es nicht zu tun, weil die Dinge anders geschrieben standen und man die Ertrinkenden lieber ertrinken ließ, um nicht gegen das Drehbuch zu verstoßen.
Derweil haben Aktivisten des Zentrums für Politische Schönheit längst das Geschäft mit echten Leichen von im Mittelmeer Ertrunkenen entdeckt, die sie am liebsten direkt vor dem Bundeskanzleramt in Berlin abgeladen hätten, Eskalation und Mahnung in einem, und es darf einen wundern, dass es noch keinem von den begnadeten Künstlern eingefallen ist, mit Vergnügungsschiffen vor der libyschen Küste herumzukreuzen und ihren Anhängern ein noch viel groteskeres Schauspiel zu bieten. Denn dort könnte ein zahlendes Publikum zwischen zwei Unterhaltungsprogrammpunkten an Bord von den Sonnendecks aus zusehen, wie die Schlauchboote der Flüchtlinge von der Küste ablegen, und Wetten abschließen, ob sie kentern würden oder nicht und ob im Ernstfall die Boote der Hilfsorganisationen rechtzeitig zur Stelle wären. Der Regisseur, ein Fetischist des Echt-ist-nur-was-echt-ist, könnte dann immer noch entscheiden, ob man eingreifen würde, je nachdem, ob er eher der interaktive Typ wäre oder Anhänger eines Theaters, in dem zwischen Schauspielern und Publikum eine unüberwindbare Barriere besteht, und man könnte vor dem sechsgängigen Abendessen im Viersterne-Restaurant noch die Rettungsboote klarmachen oder sich aus prinzipiellen ästhetischen Überlegungen entschließen, es nicht zu tun, weil die Dinge anders geschrieben standen und man die Ertrinkenden lieber ertrinken ließ, um nicht gegen das Drehbuch zu verstoßen.
Das Spektakel der Wildwest Show erreichte einen zynischen Höhepunkt, als darin auch das Mädchen auftrat, das im Babyalter auf dem Leichenfeld von Wounded Knee überlebt hatte. Sie war in den Armen ihrer erschossenen Mutter, unter deren steifem, im eigenen Blut erstarrtem Körper geschützt gegen den frisch gefallenen Schnee und die Januarkälte, erst viele Stunden, ja, nach Quellen erst unglaubliche zwei Tage nach dem Massaker aufgefunden worden, wie durch ein Wunder von keiner Kugel verletzt und wie durch ein zweites Wunder nicht erfroren, und wirkt wie eine ferne Schwester des ertrunkenen syrischen Jungen, der im Herbst 2015 so allein wie nur je ein Mensch auf einem türkischen Mittelmeerstrand mit zu Boden gekehrtem Gesicht im Sand gelegen ist und dessen Bild und dessen Verlassenheit die ganze Welt zu sehen bekommen hat. Sie hieß Zintkala Nuni, Lost Bird, er Aylan Kurdi, auch ein kleiner verlorener Vogel, und hier hört das Spiel auf, hier ist das Ende der Spektakel erreicht, weil ein Toter keinen Toten spielen kann, weil der Tod kein Spiel ist, sondern immer echt.
