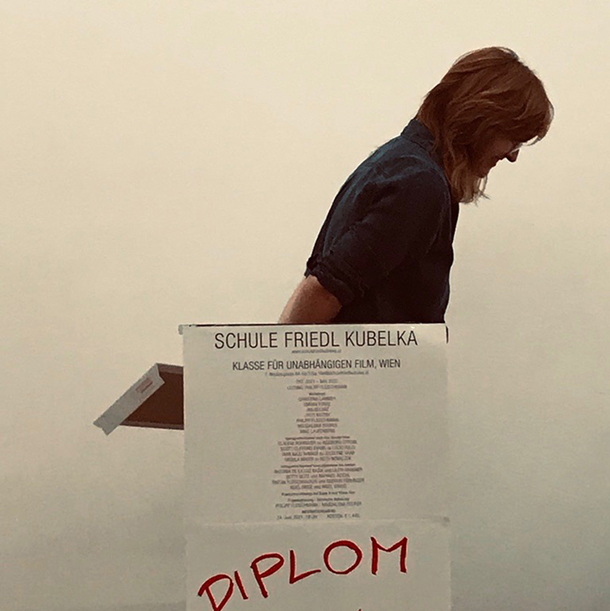
Welche Spuren in Form von Einflüssen und Notwendigkeiten aus verwandten Künsten, aus der Populärkultur, aus fremden Leben finden sich in einem Werk? Die Suche nach den eigenen, selbst gepflanzten Wurzeln ist auch ein Nachspüren und Nachgehen, wie die (eigene) Sprache zirkuliert und was sie zum Klingen bringen kann.
1. Raw like Sushi
Das Kind, das die Autorin einmal war, ist so sehr geprägt von der volkstümlichen Musik und den Schlagern aus dem Radio oder den Zeltfesten in der Gegend, dass es Jahrzehnte später noch zwanghaft mitsingen muss, wird irgendwo so ein Evergreen angespielt, ähnlich arg ist es ansonsten nur mit Kirchenliedern. Schließlich kommen die populären Songs der Hitparade und das auf billige Musikkassetten kopierte Gesamtwerk von Ambros, Grönemeyer und Konstantin Wecker hinzu.
Im Elternhaus gibt es ebenso wenig Schallplatten wie Bücher, also keine. Aber als sich einer der älteren Brüder (endlich!) eine Kompaktanlage mit Plattenspieler besorgt, bekommt die 16-Jährige ihre erste LP geschenkt. Suzanne Vegas Solitude Standing mit Tom’s Diner und Luka eröffnet der Einserschülerin (allerdings nur in Deutsch und Musik) zum ersten Mal eine neue, andere Welt, wie man Geschichten erzählen kann: In einem Diner, naja, Kaffeehaus sitzen und einfach aufschreiben, was da alles ist, in der Öffentlichkeit solitär sein oder zumindest allein unter anderen, das lässt die eigene Existenz im Café Belvedere in der Grazer Innenstadt, in dem die Schulschwänzerinnen ihre Vormittage verbringen, in einem neuen Licht erscheinen. Aus der Perspektive eines misshandelten Kindes sprechen.
Frischmuth, Frisch und Innerhofer im Deutschunterricht, Patti Smith, Joni Mitchell und Suzanne Vega aus den Boxen, später PJ Harvey, Fiona Apple, Roisin Murphy.
Das alles gab es schon in der Literatur, in der Bildenden Kunst, im Film und die Schülerin erarbeitet sich recht viel davon, so gut es halt geht ohne familiäre Vorbildung oder bürgerliche Heranführung, aber in der Musik, im Pop ist alles direkt zu haben, zu erleben, zu sein.
Es ist nicht nur die Art, wie diese Texte gebaut sind, direkt und beiläufig zugleich, fragmentarisch, es ist vor allem die Stimme der Singer-Songwriterin, die die Hörerin direkt erwischt, logisches Phänomen, in Sprache, Musik, Gesang.
Die Stimme mischt Sinnliches und Sinn, ist Materie und Geist, ist immer physisch und psychisch zugleich, demonstriert Macht und offenbart Ohnmacht, die Sprache ist an den Körper gebunden, ohne diesen ist kein sprachlicher Ausdruck denkbar.
Roland Barthes spricht vom „Korn der Stimme“, wenn die Sprache (natürlich auch von französisch Zunge) mit der Stimme zusammentrifft. In einem Interview sagt er: „Die Stimme ist wirklich der Ort des Körpers, der zugleich am meisten begehrenswert und am sterblichsten ist, gewissermaßen am herzzerreißendsten (…) Die Rauheit der Stimme ist in der Verführung, eben gerade in der Abwesenheit des unbekannten Körpers, der unterhalb der Stimme ist und der auf eine geheimnisvolle Weise in die Stimme übergeht.“ Barthes‘ Rauheit wird mittlerweile mit Körnung übersetzt. In der Körnung der Stimme kann jener emotionale Zustand herausgelesen/gehört werden, den Barthes als Haltung aufgefasst hat.
Als die junge Schülerin kurz nach Suzanne Vega auf die isländische Punk- oder Postpunkband Sugarcubes trifft, kommt zur bloßen Möglichkeit des Geschichtenerzählens noch die erstaunliche Erkenntnis hinzu, dass sie selbst etwas schaffen/schöpfen könnte – vermittelt durch die Stimme Björks und vielmehr noch jene von Neneh Cherry auf Raw like Sushi: außer sich sein, schreien, alles herausschreien, sich, und, als wäre man für die Momente des Hörens oder Tanzens selber Punk, Anarcho, Underground, obwohl in Graz oder Salzburg … naja … Die Turbulenzen in Björks Stimme vereinen Schmerz, Kummer und das schöne Leben, stellen alles in Frage. Zur Legende gehört, dass sich die Sugarcubes an dem Tag gründeten, an dem Björk ihren Sohn zur Welt brachte. Neneh Cherry, die irgendwer auch einmal Joni Mitchell of HipHop nannte, mischt verschiedene Stile, Stimmungen, macht alles, wie sie will, nimmt sich vom Alten, was sie braucht, zitiert, aber es ist auch klar, dass die Vergangenheit als solche abzulehnen ist, damit wirklich etwas Neues entstehen kann. Privat und politisch schließen sich nicht aus, müssen sich aber auch nicht die Waage halten. Neneh Cherry performt immer wieder hochschwanger, in den Videos taucht dann ein Säugling an ihrer Schulter auf, was sie nicht weniger attraktiv, sexy und selbstbewusst erscheinen lässt. Es ist selbstverständlich ihr Körper.
Hell, kalt und scharf ist diese Stimme.
Schrill und souverän.
Rau. Wirklich grobes Korn in aller Helligkeit.
Heute seien die weiblichen Stimmen laut einer Studie aus dem Jahr 2017 und im Vergleich zu zwanzig Jahren zuvor tiefer – weil die Frauen sich emanzipiert hätten, aber das ist nur eine Version, die die „aus dem Körper gekippten Stimmen“, wie Ines Geipel es nennt, die Piepsstimmen in den Kinderserien, auf Instagram und den unzähligen Youtube-Channels ausklammert.
Die Schreie Neneh Cherrys oder Björks konnten Geburtsschreie, schöpferischer Akt, Wut, Liebe, Poesie und Politik zugleich sein, alles mögliche, was an Unzeitgemäßem in der Stimme mitschwingt, sie entziehen sich der Bewertung, der Behandlung, der Einordnung.
Ohne sie und die weiblichen Pop-Stimmen der 80er-Jahre wäre aus einer wie mir wohl nie eine Schreibende geworden. Körnung, Rauheit und Turbulenzen sind der Körper in der singenden Stimme und in meiner schreibenden Hand.
2. Godard-Prinzip
„Aber es gibt keine individuellen Lösungen, weißt du? Man lernt, indem man kämpft. Du akzeptierst Dinge zu schnell.
Es ist mein Recht, mit Frauen Probleme zu haben.
Frauen, Geld: Es ist eigentlich ganz einfach. (Pfeifen von Paul, ebenso laut wie Robert, der weiter spricht.) Es ist wie eine Bewegung – eine kontinuierliche Rebellion. Ich kann Dinge nicht wie du akzeptieren. Deshalb bin ich Aktivist.
Ich bewundere dich dafür.
Dann mach mit.
Ich denke darüber nach. Was liest du?
Einen Artikel über Bob Dylan“
Ein Ausschnitt aus einem Filmdialog aus Masculin – Feminin oder: Die Kinder von Marx und Coca-Cola von Jean-Luc Godard aus dem Jahr 1966: Individuum und Gesellschaft, Frauen, Aktivismus, Rebellion, ein Artikel über Bob Dylan. Vieles wird direkt miteinander in Beziehung gebracht oder zumindest nebeneinander gestellt, die Wendungen sind wie in den meisten Filmen Godards nicht überraschend, sondern unvorhergesehen. Und alles hängt mit allem zusammen.
Zum ersten Mal gesehen habe ich den Film rund zwanzig Jahre nach seinem Erscheinen, wahrscheinlich in den Kunststücken auf FS 2, der ORF-Kultursendung, Original mit Untertitel, spätnachts und manchmal heimlich, was allein schon eine gewisse Magie hatte und die große Kinoleinwand zwar nicht ersetzen, aber doch etwas kompensieren konnte.
Godards Film adaptiert zwei Erzählungen von Guy du Maupassant zu einer losen, filmischen Handlung, die Geschichte von Paul, Robert, Madeleine und ihren Freundinnen wird fragmentarisch erzählt, sehr undramatisch, es wird nicht in Hauptfiguren- und Nebenhandlungen und -schauplätze unterschieden. Und doch wird erzählt.
Details und was am Rand des Bildausschnitts passiert, Widersprüchlichkeiten und erzählerische Vielfalt vor allem, aber nicht nur auf der Ebene der Montage. (Die deutsche Regisseurin Angela Schanelec treibt diese „Randerscheinungen“ fünfzig Jahre später weiter, scheut sich auch nicht davor, dass zum Beispiel Verkehrslärm die Dialoge beinahe übertönt.)
Vielleicht einem Aphorismus Kafkas nicht unähnlich: „Sich als etwas Fremdes ansehn/Den Anblick vergessen/Den Gewinn behalten“ schneidet/montiert Godard aneinander, was nicht zusammengehört.
Während die lineare Erzählung, jene, die im Fluss bleibt, und im Film die konventionelle Montage, welche das Raum-Zeit-Kontinuum erhält, die größere Illusion erzeugen, ermöglicht ein Film aus lauter Einzelbildern oder einer, in dem „eins nicht zum anderen passt“ (Godard) die Möglichkeit, die Leerstellen im Kopf mit eigenen Bildern zu füllen. Dafür verantwortlich ist das Dazwischen, das im Unverbundenen entsteht, und ein Kino (eine Erzählung, ein Thema) im Kopf ermöglicht, das dem Prozess der Erinnerung vergleichbar ist. Nicht alles erklärt, beantwortet. Raum und Zeit als absolute Kategorien werden aufgeweicht, kein simpler Realismus mehr, Poesie statt oder mit Handlung – Amos Vogel nennt das in seinem Buch über Avantgardefilm die „Subversion des Inhalts“.
Filmische Sequenzen, vermehrter Gebrauch von Montage und Schnitt, Kamerazoom und Focus usw.: Um etwas zu beschreiben, das ich in der Literatur versuche, mögen derlei Vokabular und Vergleiche brauchbar sein. Aber Texte sind Texte und keine Filme, es gibt keine bewegten Bilder, es gibt keine Kameraaufnahmen, Kamerafahrten in Texten, am ehesten noch (aber natürlich auch nicht) gibt es Stills, abfotografierte Momentaufnahmen wie im Film. Hilfsmittel, die etwas über die Nähe und Distanz der Erzählerin zu ihren Figuren aussagen, über stufenlose Perspektivwechsel, vielleicht auch über die Beweglichkeit und Anschaulichkeit des Be- und Geschriebenen. Nicht nur, um das, was mich zum Sprechen und v.a. Schreiben bringt, mit zu benennen, zitiere ich Bewegtbilder in meiner Literatur. Die verschiedenen Möglichkeiten und v.a. natürlich Unmöglichkeiten der unterschiedlichen Medien sind mir dabei sehr wohl bewusst. Das Nebeneinander der Dinge, die Wahrnehmung in Fragmenten und auch simultanes, multiperspektives Wahrnehmen statt linearer Wahrnehmung kann wohl auch in der Literatur aufgefunden werden, in der Lyrik, im literarischen Essay, in einer Prosa, die heute kaum noch verlegt wird.
Mit Amos Vogel (und Kracauer, Kluge u.a.) würde ich Film als „vielleicht einflussreichste Kunst des [20.] Jahrhunderts“ bezeichnen. Film mit der ihm inhärenten Bewegung ist auf eine Zukunft hin ausgerichtet, das kann Literatur so nicht.
Der Essayfilmer Harun Farocki stellte fest, dass es „heute immer noch schwierig [ist], dem gerecht zu werden, so überraschend-komisch operiert Godard gegen alle Regeln“ – in diesem Fall spricht er über Le Mepris/Die Verachtung, gemeint ist aber natürlich der ganze, auch der theoretische Godard mit seinen Filmgeschichten, seiner Filmgeschichte. Dass Godard nicht politische Filme machen wollte, sondern politisch filmen, ist ja schon fast ein Spruch fürs Stammbuch von uns Künstlerinnen. Die Gegenüberstellung von Bildern, zeitliche Koinzidenzen, unbestimmte – offene – und doch gemeinsame Bezüge persönlicher, gesellschaftlicher Momente und Ideen, Modelle statt Abbilder, nicht ein endgültiges Bild, sondern die Bewegung des Dargestellten, der Erzählung, die zur Reflexion wird, Finden statt Erfinden und vor allem, die Regeln brechen, nicht zuletzt die eigenen: Ich kann Godard natürlich noch weniger gerecht werden wie Farocki, noch Literatur schreiben wie Schanelec heute Filme macht, aber Godard immer wieder ansehen, vergessen und neu schreiben und vor allem – sich selbst überraschen, oder, um noch einmal Kafka und Godard zu zitieren:
„Dreierlei:
Sich als etwas Fremdes ansehn
Den Anblick vergessen
Den Gewinn behalten
Oder nur zweierlei, denn das Dritte schließt das Zweite ein“.
Und dies: „Ich bewundere dich dafür./ Dann mach mit./ Ich denke darüber nach. Was liest du?“
3. Landschaften, Verkörperungen
Man stellte eine Literaturzeitschrift zusammen, las auf Vernissagen in neuen Galerien, von denen einige auch blieben, und wenn man die war, die halbwegs gut organisieren konnte, wurde man zur Produzentin eines Kurzfilms für einen befreundeten Regisseur. Weil ich die Texte von Herta Müller verstehen und besser kennenlernen wollte, überlegte ich mir, Passagen daraus in einer szenischen Lesung auf die Bühne zu bringen, im Theaterdock, damals noch in der Lehrter Straße war das, aber einige andere Orte im Berlin der 90er Jahre wären dafür ebenso in Frage gekommen. Es war fast noch die analoge Zeit, ich bat die Autorin per E-Mail um Erlaubnis, ob der Verlag involviert war, weiß ich nicht mehr.
Wie gesagt, alle machten verschiedene Sachen, organisierten Projekte miteinander, allein, mit Freundinnen und neuen Bekannten, und wenn es der Prozess der Aneignung und Verkörperung, der Auseinandersetzung mit der eigenen (literarischen) Her- und Hinkunft war, die man mit einer überschaubaren, aber interessierten Öffentlichkeit teilen wollte.
Herta Müller hat die Niederungen, ihr erstes Buch (1984 in Westdeutschland erschienen) nicht geschrieben, weil sie Schriftstellerin werden wollte, sondern um sich aus der krassen Einsamkeit im Zusammenhang mit der Verfolgung und Verleumdung durch den rumänischen Geheimdienst herauszuschreiben und sich der eigenen Kindheit in einem bäuerlichen biederen Dorf im Banat zu vergewissern, sich ihrer selbst klar zu werden. Ihr Schreiben kam aus dem Schweigen in der politischen Verfolgung, aber auch aus dem kaum miteinander Reden im bäuerlichen familiären Milieu. Der Tod des Vaters eröffnet die titelgebende längste Erzählung, abschließend fällt die Erzählerin in ein Tintenfass. Die weißen Gummiwarzen am Strumpfhalter und Chrysanthemen, mitunter „eingerollt am Gesicht der Mutter“, die waren in meiner Kindheit ähnlich vorhanden wie in Müllers früher Prosa (und dann eben auch in meiner eigenen, was ich beim Schreiben nicht bedachte, erst später wieder fiel es mir auf).
Sprache muss unverbraucht und neu sein, will sie sich relevant äußern zur Welt, in der sie hervorgebracht wird, will sie politisch sein (auch wenn es für Müller keine politische, sondern nur eine individuelle Form gibt). Die Erzählerin schält sich aus dem Deutschen heraus, aber ins Rumänische nicht vollständig hinein. Im Dialekt heißt es: „Der Wind geht“, im Hochdeutschen „Der Wind weht“ – etwas tut sich weh – und schließlich „Der Wind schlägt“ im Rumänischen, tut anderen weh. Wenn sich der Wind dann gelegt hat, also „stehen geblieben“ ist, ist das eine Verschiebung wie, aber auch jenseits von Metonymisierung und Metaphern, ein Umbruch ins Neue, das Grausames, Groteskes aus Kindheit und Katastrophe des Aufwachsens verstörend, aufwiegelnd erzählt. Aglaja Veteranyi, die zweite große in Rumänien geborene und auf Deutsch schreibende Schriftstellerin dieser Generation wäre da vielleicht auch noch zu nennen.
Neben den Frauenfiguren in den Familien und dem Nebeneinander der einzelnen Generationen in diesem mir fremden Land und System interessierte mich sehr die Wahrnehmung in den Prosatexten. Mich interessierte der doppelte Wahrnehmungsvorgang, bei dem sich der Blick in die Außenwelt mit den Blicken ins Innere vermischt; die Wirklichkeitsaneignung, die weit über die Aufnahme von Fakten hinausgeht; jene erkennende Wahrnehmung in Sprichworten wie jenem der Großmutter: „Der Teufel sitzt im Spiegel“, das ist für die Umgebung eine Gefahr und für die, die sich selbst ansieht, sowieso; wie die Wahrnehmung sprachlich so nahe an ihr Objekt, an die Körper, Gefühle, herankommt, bis alles in seine Einzelteile zerfällt und dann neu und anders wieder zusammengesetzt wird.
Vielleicht kann man von einem prothesenhaften Schreiben sprechen – und irgendwie steht diese die Körperteile auseinandernehmende Literatur, in dem die Zähne nicht aufeinander passen, Gliedmaßen in der Nähe des dazugehörenden Körpers herumliegen, ein Akkordeon für die Arme und Beine der Männer und Frauen den drückenden Tango spielt, irgendwie steht diese Prosa Müllers auch invers und wortbildlich zu dem, was sie, die Nobelpreisträgerin von 2009, seit langem hauptsächlich macht, nämlich lyrische Collagen aus ausgeschnittenen Wörtern und Buchstaben.
„Das Dorf steht wie eine Kiste in der Landschaft.“, heißt es einmal. Das Dorf der Kindheit ist eine Kulisse, die Protagonist*innen sind schweigende, trinkende, immerzu weinende fragmentierte Verkörperungen von Einschreibungen und Zumutungen. Es ist geradezu synästhetisch, wie die Landschaft und ihre Geschichte in die Bewohner übergeht, wie die Grenzen zwischen Umgebung, Wetter, Mensch und Inventar niedergerissen werden. Die Baumkronen sind Röcke, der Hof kam die Nacht beinhalten (voller Nacht sein), die Nacht hat keine Jahreszeit (weil man sie nicht sieht). Landschaft, Herkunft, Familientrauma und das drückende Schweigen sind dem Kind eingeschrieben, es wird selbst Teil dieser Niederungen. „Die Vögel waren ausgezehrt und blieben schreiend in der Luft. Der Hunger flatterte.“ Aber es ist eine kubistische Synästhesie, keine romantische, deren Mehrsprachigkeit und Mehrspartigkeit auch das totale Verschweigen enthält.
Ich gab der szenischen Lesung den Titel „Über den Riss in der Landschaft“, projizierte S/W-Bilder rumänischer Dorffeste aus den 80er-Jahren an die hintere Bühnenwand und ließ während der Lesung ein Mädchen mit einem Fahrrad davor herumfahren. In dem Kuvert, in dem ich die Kopiervorlage für das Poster der Ankündigung aufbewahrte (so viel war noch analog!), fand sich außerdem ein Programmzettel vom Prater der Volksbühne zu einem „choreographischen Theater“ mit dem Titel „Sylvia Plath“ von Johann Kresnik, das ich wohl ungefähr zur selben Zeit besucht haben dürfte. Natürlich war ich nicht allein beim Kombinieren und Verwursten der verschiedenen künstlerischen Genres. Natürlich sprechen die Texte für sich selbst – und wie! –, aber beim Begreifen, vielleicht sogar Verstehen, hat mir, der Lesenden, Vorlesenden, Inszenierenden geholfen, wenn schon nicht alles, so doch möglichst viel zusammenzubringen – und die rezeptive Anwesenheit eines Publikums sorgte für zusätzlichen Erkenntnisgewinn.
4. Moos/Clouds (Exkurs und vorläufiger Schluss)
Moose zählen wie Farne und Flechten zu den ältesten lebenden Pflanzen der Erde. Sie sind blütenlose Sporenpflanzen, die sich durch Generationswechsel fortpflanzen, was bedeutet, dass sich die geschlechtliche und ungeschlechtliche Fortpflanzung von Generation zu Generation abwechselt. Wasser können sie nur durch die Luft oder durch Niederschläge aufnehmen. Moose können sehr alt werden.
Nicht nur einem Foto lässt sich nichts hinzufügen, weil es randvoll sei, so Roland Barthes in der Hellen Kammer; alle Autoren, zitiert er Sartre, würden darin übereinstimmen, dass die Bilder, die die Lektüre eines Romans begleiten, armselig seien: „Bin ich von einem Roman in Bann geschlagen, entsteht kein Bild in mir. Dem BILD-MINIMUM der Lektüre entspricht das BILD-MAXIMUM des Fotos; nicht nur, weil es bereits ein Bild in sich ist, sondern weil dieses ganz spezielle Bild sich als vollständiges ausgibt …“
Lange Zeit war es so: alle paar Jahre ein neues Autor*innenfoto, zum neuen Buch etwa. Aus dem Punktum, der Nachbildung bedeutsamer Momente, ist längst die Punktwolke geworden, die suggeriert, dass jeder Raum, jeder Ort messbar und darstellbar und an einem unbekannten Ort speicherbar ist. Die Autorin sollte zu Werbe- und Marketinggründen ihre Social-Media-Accounts pflegen, am wirksamsten sind Selfies. Ich bin permanent viele, das wissen wir schon lange. In der digitalen Verwertung des Selbstportraits (Selfies) bin ich nicht nur immer und vielfach ein anderer, ich bewerte und werte, ich bin permanente Augenzeugin, ich gebe vorgegebenen Suchbefehlen nach und schaue und schaue, folge Spuren von Verletzung, Verhöhnung, Selbstdarstellung und Spektakel, setze der Bilderflut eigene, immer neue Bilder entgegen. Die permanente Vergewisserung, hier zu sein und gleichzeitig da. Im Netz und an einem herzeigbaren Ort. Als funktionierende Identität nur existent in der Bestätigung anderer (aller anderer, möglichst vieler). Zugleich ist nicht ein Überschreiben oder Auslöschen, wie man es vielleicht für eine vergangene Bilderfolge vermuten könnte, im Gange, sondern das Verwischen von Gesehenem (und Geschehenem?). Bilder haben sich in uns eingebrannt und verschwinden, als hätten sie gar nie existiert. Die Leere ist ein Ort in unserer Wahrnehmung. An Unterscheidungen und Zusammenhängen von Moos, Flechten und Clouds wird noch zu arbeiten sein, an Texten ohne die Zugabe von Hashtags umso mehr.
* * *
