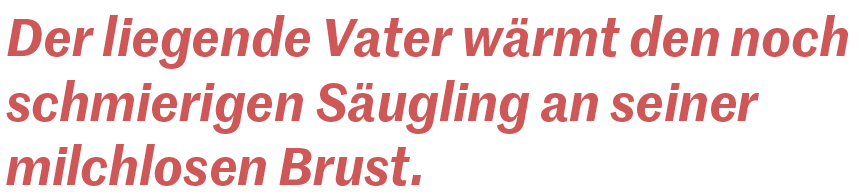Es gab eine Zeit, in der Männer über einsame geistige Höhen spazierten oder ins dunkle Herz Afrikas vordrangen und darüber schrieben, nicht nur vom Schreibtischstuhl aus. Melville ist tatsächlich zur See gefahren, ebenso Joseph Conrad. Nietzsche kam immerhin hinauf bis Sils-Maria. Ihre Kinder, so scheint es, waren ihre Bücher, auch wenn sie menschliche Kinder hatten. Mit beiden Arten von Nachkommen hatten sie nicht immer Glück, ein Sohn Melvilles nahm sich achtzehnjährig das Leben, Nietzsches Schriften fanden (zunächst) kaum Leser.
Heute gehen Männer mit ihren Kleinen zur Eingewöhnung in die Kita, sie schubsen Kinderwagen, sie wechseln Windeln und sitzen Elternabende ab. Darüber schreiben sie nun auch. Leander Scholz hat einen Essay Über Kinder und Politik veröffentlicht, Michael Chabon eine Sammlung von Aufsätzen über Fatherhood in Pieces. Der dunkle Kontinent ist nun im Zweifelsfall eine Modewoche in Paris, die geistige Höhe findet sich auf Augenhöhe mit dem Nachwuchs. Vaterschaft erweist sich als Abenteuer; unsere Männer sind Pioniere geblieben, Helden mit dem kleinen Löffel. Darum geht es:
Distanz
Die Geburt ist ein Drama. Dem Vater wird schwindlig und „die Ärzte“ überlegen, ob ein „Eingriff“ nötig sei. Die Mutter wird operiert, der liegende Vater wärmt den noch schmierigen Säugling an seiner milchlosen Brust. Scholz schreibt von der Angst im Vorhinein, kein guter Vater werden zu können, die Nähe zu seiner Frau zu verlieren. „Mein ganzes bisheriges Leben schien auf einmal infrage gestellt zu sein, die Art, wie ich es geplant und eingeteilt hatte“, schrieb der Autor bereits in dem diesem Buch vorausgehenden Artikel in der Welt vom 21. Februar 2015. Der Angst-Begriff taucht im Buch mehr als ein Dutzend Mal auf, Hoffnung dagegen nur drei Mal, Mut beinah ausschließlich als Bestandteil des Wortes Mutter. Je einmal spricht Scholz von dem Mut und der Zuversicht seines Vaters. Diese Grundierung des Textes scheint mir symptomatisch für die Diskussion des gesamten Themas in den letzten Jahren. Jedenfalls in unseren Breiten. Die Selbstverständlichkeit ist weg, um Kinder zu bekommen, braucht es beinah schon Trotz. Geburtsstillstände, Saugglocken, ohnmächtige Väter, Eltern, die sich mit einem Schlag in eine vergnügungsfeindliche Umwelt katapultiert sehen und sich ihr erzieherisches Versagen vom ersten Tag an Schritt für Schritt bestätigen. Verhaltensauffällige und depressive oder übermäßig angepasste und leistungsbereite Kinder prägen die öffentliche Wahrnehmung. Wo ist es mit uns hingekommen?
In einem Ton, der manchmal jugendbuchhaft erscheint („Ein Kind wird gezeugt, indem sich eine Frau und ein Mann sexuell vereinigen“ – o.k., das würde man nicht in einem Jugendbuch schreiben), versucht Scholz eine Bestandsaufnahme. Als Philosoph beginnt er bei Platon und den alten Römern, erklärt das christliche Familienbild und bettet so die gegenwärtigen Konzepte von Familie in die abendländische Tradition ein. Ein bisschen mehr hätte er, wenn schon, über Rousseau und die Folgen schreiben können, über Ellen Key, Maria Montessori und die zahlreichen Pädagogen des 20. Jahrhunderts, die glaubten, nichts geringeres als eine Besserung des Menschen und damit der Welt ins Werk setzen zu können. Dann kam der Neoliberalismus und mit ihm das World Wide Web, in dem alle Utopien, auch die Kindheit, vorläufig verschwunden sind. Nicht anders als der Rest der freien Welt sind ja auch die Erzieher längst gut geworden und es gäbe nicht viel auszusetzen, wären da nicht das Smartphone und Netflix, das Mobbing in den sozialen Medien und ADHS, die Essstörungen und das Ritzen, die Überanpassung … aber davon sprachen wir bereits.
Leander Scholz breitet in seinem Essay nicht seine Befindlichkeiten aus. Er versucht eine Bilanz der bundesrepublikanischen Gegenwart und fordert eine „neue Politik“. Beständig wechselt er zwischen den eigenen Erfahrungen und der Analyse sowie seinen Forderungen an die Gesellschaft hin und her. Dabei wird er selten episodisch, die Rückbindung seines Textes an den eigenen Erfahrungshorizont bleibt distanziert bis abstrakt: „[Ich hatte] mir vorgenommen, möglichst viele sexuelle Erfahrungen zu machen, die mich an die Grenze meines Ichs führen sollten. Ich wollte … mich in möglichst ungewöhnlichen Situationen austesten, um so herauszufinden, wer ich eigentlich war“, schreibt er etwa, ohne dazu ein Beispiel zu geben. Es ist eine Eigentümlichkeit seines Essays, die Erfahrungswelt auf Distanz zu halten. Dies soll ganz sicher kein Bekenntnisbuch sein, aber manchmal kommt es mir vor, als befände sich eine Folie zwischen Leben und Text. Möglicherweise rührt das von dem Versuch her, ein Amalgam aus Erzählung und Lehre zu schaffen, in dem sich die Kanten, die den kleinen Vorläufer-Essay knackig machten, völlig verschliffen haben.
An manchen Stellen, etwa wenn er seine Wut schildert über den Menschen, der seine schwangere Frau angefahren hat, hätte ich mir etwas mehr Beharrlichkeit gewünscht. Die Reflexion auf das, was genau die Wut bedingt, ob sie anders gewesen oder gar ausgeblieben wäre, wenn die im Buch namenlose Frau nicht das Kind im Bauch getragen hätte, wie ein (werdender) Vater sein Verhältnis zur Welt ändert, woher der Anspruch kommt, alle Welt müsse mit der neuen Situation der werdenden Eltern mitfühlen und sich der (empfundenen) Zerbrechlichkeit eines besonderen Zustandes entsprechend verhalten, fehlt leider. Auch wenn es um das Ungewöhnliche seines eigenen Verhaltens geht, hätte ein bisschen mehr Verankerung im Alltag dem Text gutgetan.
Neuer Vater
Scholz ist nämlich, oder war es in den Monaten, in denen er Elternzeit nahm, ein neuer Vater. Anders als die meisten Männer hat er Nachteile im Beruf in Kauf genommen und sich anderthalb Jahre lang um sein Baby gekümmert, während die Mutter arbeitete. Der Autor beschreibt die auf die Arbeitswelt fixierten Reaktionen seiner Umwelt auf diese Entscheidung. Den eigenen Konflikt spart er dabei nicht aus, entdramatisiert ihn jedoch gewissermaßen und schreibt recht rational darüber: „Am Anfang fiel es mir nicht leicht, Ausgaben zu tätigen, die nur mich betrafen (seine Frau war zu dieser Zeit Alleinverdienerin – allein das Wort wäre eine Betrachtung wert gewesen …). Bis ich wirklich verstand, was es bedeutet, eine Familie zu sein: keinen Unterschied mehr zu machen zwischen Mein und Dein.“
Pam, da steht so ein Hammer mitten in einem anderthalb Seiten langen Absatz! Ganz harmlos und ohne weitere Erklärung, von einer emotionalen Färbung zu schweigen. Ins Psychologische gewendet, erscheint diese Aussage sofort problematisch. Die Familie ist doch viel eher der Ort, an dem alle unausgesetzt die Grenze zwischen Ich und Du und Wir bestimmen, bestimmen müssen, um nicht untergerührt zu werden. Der Ort, an dem Kinder, wenn es gut geht, das Eigene, ihre Individualität, gewinnen und Eltern aufpassen müssen, dass sie ihr Eigenleben nicht vollständig aufgeben (das tut schließlich keinem gut). – So jedenfalls kommt es mir vor. Zum Glück zeigt Scholz auch eine Tendenz in diese andere Richtung: „Erst durch Fürsorge und Erziehung werden die Menschen zu Individuen, die in der Lage sind, selbständig zu sein“.
Interessant ist seine Entgegenstellung von staatlichen und herkömmlichen familiären Strukturen. Die traditionelle, jahrtausendealte Familie stellt er als eine leicht mafiöse Struktur da, die mit Vetternwirtschaft und Verschworenheit dem Staat die Stirn zu bieten weiß. Für die moderne und demokratische Gesellschaft stellt diese Art der Familie ein Hindernis dar und ist entsprechend transformiert worden. Gut schildert Scholz auch den Druck der neoliberalen Gesellschaftsordnung, der eine glückhafte Reproduktion beinah unmöglich macht, und auf Kosten der Zeit, die Eltern und Kinder miteinander haben sollten (sowie auf Kosten der Nerven, die sie füreinander haben sollten), die menschlichen Ressourcen vollständig auszubeuten versucht: Alle sollen arbeiten und als erfolgreich gelten diejenigen, die mehrere Kinder großziehen und außerdem noch in Vollzeit beschäftigt sind.
Im Kapitel über Feminismus und Familie ist vor allem die Beobachtung interessant, dass viele Frauen den traditionell mütterlichen Bereich nicht aufgeben wollen, und Männern gern mal die Kompetenz absprechen, wenn es ums – emotionale wie äußerliche – Versorgen der Kleinen geht. In der allgemeinen gesellschaftlichen Betrachtung findet sich dagegen eine halblinksideologisch fundierte Sammlung von Aussagen, die ich gern ein bisschen untermauert gesehen hätte. Ein Beispiel: „Frauen wollen die Macht, die sie erlangt haben, anders ausüben, als Männer das tun.“ Diese bloße Behauptung validiert der Autor leider weder im Hinblick auf die Frauen noch auf die Männer.
Frauen kommen aufgrund ihrer Gebärfähigkeit als die von Natur aus empathischeren und weniger aggressiven Menschen weg und liefern damit die Voraussetzung für eine Verbesserung der bestehenden Welt: „Erst die Durchsetzung der sozialen Tugenden, die mit dem biologischen Wesen der Frau verbunden sind, wird der Welt einen wirklichen Fortschritt bringen.“ – Und was, frage ich mich, ist mit den Bitches dieser Welt? Sind die vielleicht keine natürlichen Frauen?
Ich werde hier polemischer, als ich es beabsichtigt hatte, und verspreche, darüber nachzudenken.
Selbstbeherrschung und Demokratie
Scholz’ Essay endet mit einem Abschnitt über die Demokratische Familie. Darin entwirft er ein Modell, das die staatliche Idee im Kleinen wiederholt: Aushandeln und Besprechen treten an die Stelle autoritärer Führung, auch wenn das Zeit kostet. Selbstbeherrschung gilt Scholz als Ziel der Erziehung. Er unterscheidet sie von der Disziplin: „Selbstbeherrschung heißt zu wissen, was einem guttut und was nicht … [es heißt] in der Lage [zu sein], eigene Entscheidungen zu treffen.“ Mehr Demokratie, mehr Geld für die Schulen und den sozialen Bereich, kindergerechte Stadtplanung, ein Wahlrecht von Geburt an gehören zu den Forderungen, in die der Text mündet. Die gesellschaftliche Stoßrichtung gehört in jedem Fall zu den Stärken des Textes, gerade weil sich über die Forderungen im Einzelnen gut streiten ließe.
Schließlich ist da eine Sache, über die ich innerlich nicht unwidersprochen hinwegkomme. Im letzten Kapitel seines Buches schreibt Scholz: „Oft bevormunde ich unseren [im Buch vierjährigen, Anm.] Sohn und merke es erst viel zu spät.“ Auch von geteilter Verantwortung ist da die Rede; es geht ums Aufräumen des Kinderzimmers. In diesem Absatz bündeln sich verschiedene Aspekte von Elternschaft. Zum Einen ist da die Vormundschaft, die für Eltern nicht so heißt, sondern Sorge bzw. Obsorge. (Vormundschaft ist die rechtliche Ersatzkonstruktion, wenn die elterliche Sorge nicht greift, das Bevormunden die ins Negative gewendete, weil inadäquate Spielart und als solche kein rechtlicher Begriff.) Eltern sorgen für die Person des Kindes und für sein Vermögen. Je nach Entwicklungsstand, so sagt das deutsche Recht, ist das Bedürfnis des Kindes „zu selbständigem verantwortungsbewussten Handeln“ zu berücksichtigen. Der abstrakte Maßstab ist dabei das Wohl des Kindes.
Wenn ich lese, dass ein Vater die Verantwortung, und sei es nur für die Ordnung im Kinderzimmer, mit einem Vierjährigen teilen will, provoziert mich das. Es fällt mir die Geschichte von jener Frau ein, die vor Jahren in München mit ihrem nackten Sohn im Kindersitz an einem kühlen Morgen durch die Straßen fuhr. Von der Polizei angehalten und befragt, gab sie an, das Kind habe sich eben nicht anziehen wollen. Man kommt bei solchen Anlässen gern mit der Erfahrung. Meine Erfahrung als Vater lässt mich eher denken, dass Eltern die volle Verantwortung für ihre Kinder tragen, dass sie die Entscheidungen treffen und sie im Zweifelsfall auch gegen den Willen des Kindes durchsetzen müssen. Kinder, die keine Führung erfahren, können das als sehr belastend erleben. Die Welt liegt schon auf ihren Schultern, wenn sie ihr eigenes Gewicht noch kaum tragen können.
Es steckt in Scholz’ Äußerung andererseits die Idee, ein Kind mit seinen Willensäußerungen ernst zu nehmen, ihm die Kriterien der Erwachsenen nicht einfach überzustülpen, sondern es zu achten und auf seinen kindlichen Willen Rücksicht zu nehmen. Dieser Aspekt scheint mir richtig, jedenfalls gibt es darüber eine weitgehende gesellschaftliche Einigkeit. Wir wollen längst keine Untertanen mehr, sondern mündige Bürger erziehen. Geschichten von Kindern, die in rigiden Gesellschaften nichts werden können, hat die Literatur zuhauf hervorgebracht – erinnern wir uns an Hesse oder Musil.
„An euren Kindern sollt ihr gut machen, dass ihr eurer Väter Kinder seid“, schrieb schon der Gedankenvater Friedrich Nietzsche (ich zitiere ihn nach dem 1900 ausgerufenen Jahrhundert des Kindes der mit ihren Zuchtwahlgedanken hoch problematischen, aber bis in die 1980er recht beliebten norwegischen Pädagogin Ellen Key). Der Gedanke, sich antagonistisch zur eigenen Erziehung zu verhalten, schimmert auch durch den Text von Leander Scholz. Er ist nicht neu, hat aber nichts von seiner Relevanz verloren, auch wenn die Konfliktlinien sich durch verständnisvolle, wenig konfrontative Erziehung weit verschieben.
Nähe
Ebenfalls tastend, aber auf eher entspannte Art schreibt Michael Chabon über die Vaterschaft. Der Pulitzer-Preisträger und Autor des Romans Wonder Boys hat vier Kinder, von denen das jüngste bereits in der Pubertät ist. Der Titel seiner Sammlung meist kurzer Essays wirkt leicht prätentiös: Pops – Fatherhood in Pieces. (Paps – Vaterschaft in Stücken wäre er etwa zu übersetzen.) Vaterschaft in Stücken lässt sich darin nur insofern finden, als es eben einzelne Essays sind, die das Thema umkreisen. Das Kinderkriegen als solches wird hier nicht infrage gestellt. Kernstück bildet eine Schilderung vom Besuch der Pariser Männermodewoche. Das GQ-Magazin hat Chabon eingeladen, etwas darüber zu schreiben. Seinen jüngsten Sohn Abraham nimmt er auf dessen Wunsch mit, ein Geschenk zur Bar-Mizwa. Abes Leidenschaft ist besondere Kleidung, der Junge blüht während der Tage in Paris richtig auf, während sein Vater sich bloß noch als „minder“, als Aufpasser fühlt.
Am Ende dieses unterhaltsamen, mit Spezialvokabular aus dem Modebereich gespickten Reports sind Vater Michael zwei Dinge klar geworden: der Höhepunkt für Abe war ein Event, zu dem er ohne seinen Vater gehen konnte. Und: Abe hat „seine Leute“ gefunden, seinen Stamm, die Menschen, zu denen er passt. Jahrelang hat der Junge in der Schule Hänseleien wegen seines Kleidungsticks ausgehalten, weil er auf diese Weise Gleichgesinnte finden wollte. In Paris ist es ihm endlich gelungen. Der Vater findet indes seine Freude an den besonderen Wörtern, mit denen er seine Arbeit verziert und so seine eigene Art von Verbindung mit dem Sohn herstellt.
Auch in den anderen Aufsätzen gibt es keinen grundlegenden Zweifel wie beim Deutschen Scholz, sondern ein klar ausgesprochenes Ja zur Vaterschaft und ihren kleinen und größeren Unwägbarkeiten. Beim Vorlesen von Tom Sawyer ersetzt Chabon das abwertende „nigger“ heimlich durch „slave“. Bei der Fortsetzung Huckleberry Finn, welche die Kinder unbedingt hören wollen, funktioniert der Trick nicht mehr, weil das böse Wort zu häufig vorkommt und außerdem im subjektiven Erzählerbericht von Huck Finn nicht zu ersetzen ist. Als er erklärt, wie unwohl er sich mit diesem Wort fühlt, fragen die Kinder ihn trocken, warum er denn bei Tom Sawyer das ebenfalls herabsetzende „injun“ (für die amerikanischen Ureinwohner) stehen ließ, und er antwortet, er sei eben ein „ass“, ein Dummkopf, verwendet jedoch nicht das Wort „ass“.
In einem anderen Stück macht seine Tochter sich Sorgen, eher zu normal zu sein. Oder er schreibt über „dickitude“ (was ich in diesem Zusammenhang mit „Arschigkeit“ übersetzen möchte) und wie er versucht, seinem Sohn beizubringen, sich Mädchen gegenüber nicht arschig zu verhalten. Immer schwingt mit, dass Vater Michael das ungern gesehene Verhalten durchaus im eigenen Repertoire hat; oft rätselt er: Was fühlen die Kinder, warum agieren oder reagieren sie gerade so, wie sie es tun – in der Regel nämlich kodiert und häufig in dem Versuch, den Eltern oder ihrer Umwelt eine bestimmte Reaktion zu entlocken. Gelingt das nicht, kann Schaden entstehen. Und es gelingt öfters nicht oder die richtige Einsicht kommt zu spät.
In den letzten beiden Aufsätzen nähert sich Chabon schließlich der eigenen Sohnschaft. Er rätselt über sich, weil er mit dreizehn ein T-Shirt trug, das er selbst bedrucken ließ mit dem Wort „libertine“ – zügelloser Mensch oder Freigeist. Rückblickend ist der Autor erstaunt, wie viel Mut und auch Naivität er besaß, dieses Shirt in der Schule zu tragen, und fragt sich, ob er sich bewusst war, dass die sexuelle Konnotation eigentlich die Hauptdimension des Wortes bildet.
Am Ende des Buches schildert er seinen Vater, einen Mediziner, von dem der junge Michael glaubt, er könne und wisse alles. Oft nimmt der Vater ihn zu abendlichen Hausbesuchen mit. Michael verfügt über Spielzeugvarianten medizinischer Geräte, etwa eine „needleless needle“, eine nadellose Spritze. Doch als einer der Patienten den Jungen fragt, ob er ebenfalls ein Doktor werden will, zögert Michael mit der Antwort. Innerlich spürt er schon, dass er etwas anderes sein will, ein „Typ, der gleichzeitig innerhalb und außerhalb des eigenen Geistes und Körpers leben wird, der, ohne sich von der Stelle zu bewegen, in andere Welten reist, andere Orte, andere Leben“. Möglicherweise ist Chabons Erinnerung nachträglich von seinem tatsächlichen Lebensweg eingefärbt. Die Antwort des Jungen auf die Frage nach dem Berufswunsch ist aber schlagend: ein „mad scientist“ wolle er werden. Damit trifft er die spätere Berufswahl schon recht gut.
Schönheit und Weisheit
„Merkwürdig“, schreibt Chabon als eine Art Fazit, „wie eine Beziehung – die Beziehung – die ich als wahrhaft ursprünglich ansehe, als grundlegend für Gutes wie Schlechtes, für den Bau meines Selbst, meinen Blick auf die Welt, meine Kunst, meine Art, Vater zu sein, auf einer wohldurchdachten Vermeidung jeglicher Interaktion fußt, die nicht völlig nebensächlich und gewichtslos wäre!“ Dennoch entsteht keineswegs der Eindruck, dass zwischen Chabon und seinem Vater Sprachlosigkeit geherrscht hätte. Im Blick auf das Nebensächliche, das doch die ganze Hauptsache beinhaltet, liegen auch Schönheit und Weisheit dieser kleinen Texte.
Verglichen mit Leander Scholz’ Betrachtungen zeigen sich zwei geradezu gegensätzliche Angänge: dort der von der Erfahrung nach Möglichkeit absehende, abstrahierende, ins Philosophische schweifende Text mit gesellschaftlichem Anspruch, der ein Vater-Ich kaum aufschimmern lässt – hier ein Vater, der völlig in seiner privaten Familien-Beziehung aufgeht, seine Kinder laut und deutlich liebt und keine größeren Änderungswünsche gegenüber dem Leben und der Welt äußert.
Beiden Texten mangelt die Dimension einer schwierigen oder gar misslingenden Eltern-Kind-Beziehung, die geeignet ist, das ganze mühevoll errichtete Familiengebäude gründlich über den Haufen zu werfen. Darüber hätte Scholz, der das Versagen seiner Herkunftsfamilie im Hinblick auf eigene traumatische Erfahrungen andeutet, deutlicher schreiben können. Chabon schildert in seinem ersten Text immerhin den Versuch eines anderen berühmten Autors, ihn (am Beginn seiner Karriere) im Hinblick auf Elternschaft umzupusten: Ich habe einen Rat für Sie, sagt der an Richard Ford erinnernde Schriftsteller. Kriegen Sie keine Kinder. Jedes Kind bedeutet ein verlorenes Buch. Vierzehn Bücher und vier Kinder danach weist Chabon diesen Übergriff gelassen zurück. So gehen Erfolgsgeschichten.
Kinder fügen sich aber nicht immer den pädagogischen Ideen und hohen Zielen ihrer Eltern. Sie schlagen eigene Wege ein, die Eltern inakzeptabel finden können. Manche „geraten“, werden selbstbewusst und clever, besitzen eine gewisse Selbstkontrolle und soziale Kompetenz, haben später Erfolg im Beruf. Andere missraten scheinbar. Sie werden krank oder verweigern die Schule, bauen Mist und konfrontieren ihre Eltern mit deren Versagen. Darüber zu schreiben, ohne sich nebenbei selbst auf die Schultern klopfen zu können, weil man letztlich doch so ein toller Vaterhecht ist, wäre die größere Herausforderung. Es sind noch Heldenfahrten zu erzählen.