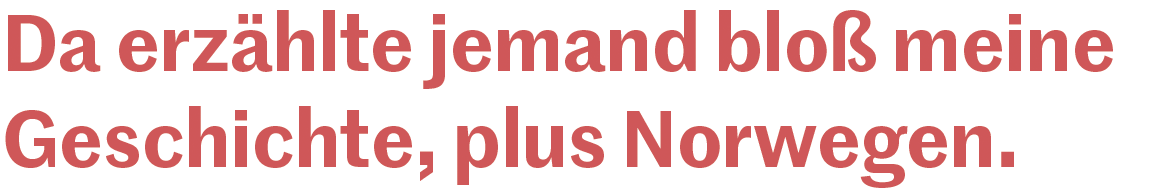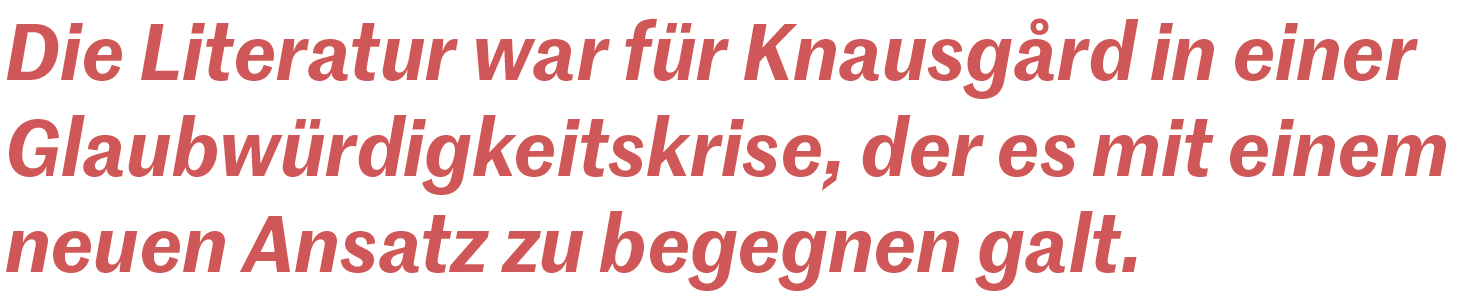Im Jahr 2011 sah ich in einem Laden ein Buch mit dem Titel Sterben. Von seinem Autor hatte ich noch nie gehört, aber der Titel und der Umschlag sprachen mich an, so ein schönes Türkis aus der Abteilung Bergsee war das. Fjord, hätte ich schreiben sollen. Ein Norweger – kannte ich einen außer Ibsen und Hamsun? Jon Fosse, aber den hatte ich weder gelesen noch eines seiner Stücke im Theater gesehen. Ich kaufte das Buch und las darin – befremdet. Es zog nicht richtig oder ich spürte nicht, wohin der Text wollte. An einer Stelle, nicht sehr tief im Buch, ging es viele Seiten lang darum, dass ein Jugendlicher in den 1980er-Jahren auf eine Silvester-Party gehen wollte. Das musste oder sollte ohne Wissen der Familie geschehen, außerdem musste der Junge Bier besorgen beziehungsweise, da er selbst keines kaufen durfte, organisieren. Mitten in dieser Schilderung gab ich auf. Da erzählte jemand bloß meine Geschichte, plus Norwegen. Sollte ich lesen, was ich ohnehin schon wusste?
Das war lange, bevor Knausgård zum Hype wurde. Erst 2015, als ich mir sagen musste, dass ich womöglich etwas verpasst hatte – denn plötzlich liebten oder hassten alle Knausgård, machte ich einen neuen Versuch. Diesmal klappte es, vielleicht auch, weil ich endlich mal hundertfünfzig Seiten an einem Tag schaffte. Ich war drin und ich nahm mir vor, nach und nach alle sechs Bände zu lesen. Lieben im Herbst 2015, Spielen und Leben im Herbst 2016, Kämpfen im Frühling 2017. Dazwischen las ich noch den Engel-Roman Alles hat seine Zeit und den ein oder anderen Essay. Knapp dreitausendsechshundert Seiten, rechne ich den Engel-Roman dazu, sind es viertausendzweihundert. Danach kann ich schwerlich behaupten, ich hätte mich gelangweilt.
Der Gegenstand all dieser Seiten ist kurz gesagt Karl Ove Knausgård (KOK), ein 1968 geborener Mann aus dem nördlichen Europa, der in einer Kleinfamilie aufwuchs, die ihre Macken hatte, und der beschloss, Schriftsteller zu werden. Der heiratete und drei Kinder zeugte, um die er sich kümmerte, ohne ein Vorbild dafür zu haben. Der Gegenstand dieses Romans ist mit anderen Worten mein eigenes Leben. Plus Norwegen. Hat das es so interessant für mich gemacht? Den Inhalt von Min kamp beschreiben die Klappentexte (leicht gekürzt) so:
Sterben: „Als [der Vater] stirbt und [Knausgård] sich mit seinem Bruder daran macht, den Nachlass zu ordnen, bietet sich beiden ein Bild des Grauens. Während sie das Haus reinigen und die Beerdigung vorbereiten, kommen Erinnerungen hoch. So sehr hat dieser Vater einen Schatten auf das Leben der Brüder geworfen, dass sie den Bestatter bitten, die Leiche sehen zu dürfen. Erst dann … werden sie glauben können, dass er wirklich tot ist.“
Lieben: „Was bleibt von all der Romantik und Leidenschaft, wenn der Alltag Einzug hält ins Leben zweier moderner, auf Selbstverwirklichung bedachter Menschen mit kleinen Kindern? Anspruch und Wirklichkeit prallen aufeinander. Das tägliche Ringen um Freiräume, Lebensfreude und Zeit wird zum unauflösbaren Konflikt. Die eigene Identität muss mit Klauen verteidigt, die Liebe immer wieder neu gefunden werden.“
Spielen: „So selbstvergessen, so selbstverloren gelingt es nur in der Kindheit – das Spielen. Karl Ove Knausgård beleuchtet eine Zeit, in der Leben gleichbedeutend ist mit Entdecken, Fürchten, Wundern. Er erzählt vom Erwachsenwerden eines Kindes, das in seinen Nöten und Höhenflügen exemplarisch ist.“
Bild des Grauens – Vater = Schatten auf dem Leben – Romantik vs. Alltag – Selbstverwirklichung, moderne Menschen – Selbstvergessenheit, Erwachsenwerden.
Leben: „Das Abitur hat er in der Tasche, die Eltern haben sich getrennt, die Begegnungen mit dem Vater sind spannungsgeladen, die ersten Schritte … begleitet von Alkoholräuschen … verheißen sie ihm doch Befreiung von all den Komplexen, Unsicherheiten und Nöten, die ihn plagen … Auf der Schwelle zum erwachsenen Leben beschließt Knausgård ein Jahr als Aushilfslehrer an eine Dorfschule nach Nord-Norwegen zu gehen.“
Träumen: „14 Jahre verbrachte Knausgård in Bergen, bevor er … nach Stockholm floh, als ginge er ins Exil … Es waren Jahre, in denen er unermüdlich versuchte, Schriftsteller zu werden, in denen schließlich seine erste Ehe scheiterte, in denen sich Momente kurzer Glücksgefühle mit jenen tiefster Selbstverachtung die Hand gaben, in denen sich Demütigungen und Höhenräusche ebenso schnell abwechselten wie selbstzerstörerische Alkoholexzesse und erste künstlerische Erfolge …“
Kämpfen: „Die Rücksichtslosigkeit anderen – aber vor allem sich selbst gegenüber. Die Radikalität des Ansatzes. Die schwindelerregenden Wechsel zwischen kleinsten Details und großen Gedanken. Die essayistischen Passagen zu Themen der Kunst- und Literaturgeschichte. Und diesmal auch: die berührende Schilderung einer Krankheit und Ehekrise.“
Alkoholräusche – erwachsenes Leben – Exil – Schriftsteller werden – Demütigungen, Höhenräusche – erste Erfolge – Radikalität – Krankheit, Ehekrise.
Aus dem Gedächtnis möchte ich ergänzen: Die Geschichte der Vernarrtheit eines 20-Jährigen in eine 13-jährige Schülerin. Die ist wichtig, weil Knausgård sie in seinem ersten Roman auf skandalöse Weise behandelt (es kommt zum Geschlechtsverkehr mit der Jugendlichen). Und der One-Night-Stand mit einer Frau, die ihn später der Vergewaltigung bezichtigen wird. Ergänzen ließen sich auch noch Fake-News, die ich von anderen Knausgård-Lesern hörte, etwa dass der Roman einen 400-Seiten-Essay über Dostojewski enthielte, oder dass er darin seinen Bruder bloßgestellt und von dessen Prozess (wegen Vergewaltigung?) erzählt hätte.
Die Zusammenfassungen zeigen, dass es nicht gerade der mitreißende Plot ist, der diese Bücher lesenswert macht. Es geht um Alltägliches, eine Jedermanns-Geschichte, setzt man den Traum vom Schreiben stellvertretend für irgendeinen jugendlichen Lebenstraum. Die Klappentexte enthüllen aber auch jene drei Themenkomplexe, die in Min kamp traditionell literarische sind: der Hass auf den Vater, die Auseinandersetzung mit dem älteren Bruder – das sind mit die ältesten Motive von Literatur, und sie entfalten bei Knausgård durchaus eine mythologische Wucht. Dazu kommt das Märchen der Liebe eher in einer romantischen als mythischen Grundierung. Dazwischen wird es ein bisschen zäh: Die Bände über die Kindheit und Adoleszenz von KOK streifen bloß diese wuchtige Motivik und bilden meines Erachtens die schwächsten der Reihe. Die Notizen zu ihnen verlor ich, als ich mein iPad neu aufsetzen musste.
Dazwischen geht es um Selbstvergewisserung, um Hölderlin und Hitler, Dostojewski und Dante, Hamsun, Van Gogh, Munch, Celan, immer wieder auch ums Schreiben, schließlich um die schmutzige Wäsche der Familie. Bei seiner Lesung in München sagte Knausgård, dass der Roman eine Kreisbewegung vollführen sollte: von der Beerdigung des Vaters zurück bis in die Kindheit und dann wieder vor über die Studienjahre bis zum Tod des Vaters. So gesehen wäre der Roman (der in Wahrheit über diesen Zeitraum hinausführt) bereits nach fünf Bänden vollendet. Dieses Gefühl stellt sich beim Lesen tatsächlich ein, denn der sechste Band ist anders, reflektiert schon die Reaktion auf das Erscheinen der ersten Bücher, die Knausgårds Beschäftigung mit den Phänomenen des „Namens“ und der „Zahl“ auslösen, mit einer titelgleichen Autobiografie und dem Leben Adolf Hitlers, der sie schrieb, außerdem dem Gedicht Engführung von Paul Celan. Den letzten Satz der Hexalogie habe er von Anfang an im Kopf gehabt, sagte Knausgård auch. Er lautet: „… werde ich den Gedanken genießen, wirklich genießen, dass ich kein Schriftsteller mehr bin.“ Das zeichnet Min kamp als Bildungsroman aus.
Der Schriftsteller selbst sprach bei der Lesung von einem concept-art-ähnlichen Ansatz, ohne das weiter auszuführen. Die Äußerung ist insofern aufschlussreich, als bei Konzeptkunst der grundlegende Gedanke wichtiger ist als die Ausführung – ein Eindruck, den man von den vorliegenden, eilig geschriebenen 3600 Seiten auch gewinnen kann. Darüber hinaus gibt die Aussage einen Hinweis darauf, dass Knausgård einen strikt künstlerischen und keinen dokumentarischen Ansatz verfolgt – er betont zudem, dass es sich bei Min kamp um einen Roman (und nicht um eine Autobiografie) handele, was auch immer man darunter verstehen mag. Darin ähneln die sechs Bücher den autobiografischen Romanen August Strindbergs. Der schwedische Autor äußerte übrigens schon 1885 (nach einem Zensur-Prozess), es könne einer nur dann Schriftsteller sein, wenn er wie ein „Vampir das Blut seiner Freunde, seiner Nächsten, sein eigenes“ sauge. Den Hinweis auf diesen Satz verdanke ich Aldo Keel in der NZZ.
Wahres, Wirkliches, Authentisches
Bei seinem ersten Erscheinen in Norwegen hat der Roman offenbar in erster Linie über den Skandal gewirkt. Da hatte also einer gewagt, über seine Familie zu schreiben und nicht mal die Namen zu ändern. Glaubt man dem sechsten Band, so suchten die Journalisten Kontakt mit real existierenden Romanfiguren und transferierten die Auseinandersetzung mit diesem Kunstprodukt vom Ästhetischen ins Gesellschaftliche, recht eigentlich in den Bereich der Klatschpresse. Aus der Distanz betrachtet wirkt all das nicht übermäßig interessant. Der Umgang mit den wirklichen Figuren wird für den Leser schwieriger, denn ihre Wahrhaftigkeit lässt sich rein literarisch nicht mehr beurteilen. In diesem Zusammenhang ist es bezeichnend, dass Knausgård sich in Kämpfen gegen den Vorwurf der biografischen Lüge letztlich ästhetisch wehrt. Sein Onkel behauptet da, die Erzählung über seinen Vater sei völlig falsch. Weder sei er ein schwerer Alkoholiker gewesen noch habe er am Ende seines Lebens über ein Jahr lang bei seiner Mutter gelebt. KOK ist verunsichert und zieht sich nicht ohne Trotz darauf zurück, dass es sich eben um sein Bild von seinem Vater handele und er das Recht habe, ihn so zu schildern.
Meistens betont KOK jedoch die Authentizität seines Lebensromans. Der Begriff taucht im gesamten Romanwerk rund vierzigmal auf, dreiunddreißigmal allein im letzten Band. Dabei verwendet der Autor ihn im alltagssprachlichen Sinn von „echt, wahr“. In einem Mail an den Onkel erklärt er, alle Namen und Ereignisse seien authentisch, „das heißt, das Erzählte ist geschehen, wenn auch nicht bis ins kleinste Detail.“ Auf der anderen Seite ist das Authentische für ihn durchaus als etwas Fiktives denkbar, wie er im Hinblick auf den „Bilderhimmel“ der Nazis äußert. In Sterben lässt er seinen Bruder Yngve sagen, das Authentische existiere nicht für sich, vielmehr entstehe es beim Rezipienten, es sei also eine Frage der Form. Yngves Sichtweise ist für den Autor ein „akademischer Königsweg“.
Das Akademische aber ist bei Knausgård ambivalent konnotiert, gegen den (postmodernen) Diskurs der Achtziger- und frühen Neunzigerjahre wehrt er sich mehrfach, er sei ihm zu kompliziert, er habe nichts davon verstanden oder – als er in Kämpfen einmal über seinen geistigen Weg schreibt –, er habe sich fünfzehn Jahre „damit beschäftigt [dass Raum relativ ist] und Denker gelesen, die dies bestätigen: Nietzsche und Heidegger, aber auch Foucault … Das Problem war, dass ich … mich im Lauf der fünfzehn Jahre … nicht vom Fleck bewegt hatte. Es widersprach ja im Grunde allem. Entstehung, Werden, Erscheinen, das ewig Neue – nur nicht in mir und meinem Verständnis.“ Immer wieder blitzen in dem Roman jedoch die Spuren jenes akademischen Denkens auf, und Knausgård benutzt es ebenso sehr, wie er es auf Schlagworte herunterbricht und diffamiert.
Entgegen seiner eigenen Aussage scheint mir die wichtigste Stilvorgabe für Min kamp zu sein, dass es authentisch wirkt. Die Schilderungen seiner Erinnerungen folgen wiederkehrenden Mustern, etwa in der Dialogführung oder in der Art der Montage, dem Herstellen von bruchhaften Überleitungen (etwa, wenn er die obige Passage über Nietzsche und Foucault folgendermaßen fortsetzt: „Ich stand auf, ging aufs Klo, um zu pinkeln. Der Urin war hell beinahe ganz blank, und ich dachte an die Pisse meines Vaters … Dunkelgelb, beinah braun hatte sie ausgesehen.“) Dass Szenen aus der Vergangenheit nicht in dieser Detailfülle im Gedächtnis eines Menschen aufgehoben sein können, ist eine Banalität, und Knausgård macht auch keinen Hehl daraus: „die Geschichte über mich … habe ich erzählt. Ich habe übertrieben, ich habe ausgeschmückt, ich habe weggelassen, und vieles habe ich nicht verstanden.“
„Es war so“
Das Beharren des Erzählers auf dem „es war so“ muss also verstanden werden als Teil eines künstlerischen Konzepts. Es findet statt, was Christian Klein in seiner Abhandlung über Kultbücher als doppelten Authentizitätseffekt darstellt: „Der Leser meint (1) authentische Rede vorzufinden, die (2) authentische Erlebnisse im doppelten Sinn präsentiert, weil sie (a) als tatsächliche Erlebnisse des Autors wahrgenommen werden und (b) eigene existenzielle Erfahrungen der Leser zu thematisieren scheinen.“ Das wäre an anderer Stelle weiter zu untersuchen.
Nur an wenigen Punkten hatte ich das Gefühl, Knausgård mache es sich ein bisschen einfach und lasse seinem Erzähler die Zügel schießen. Dazu gehören eine Szene im Band Träumen, in dem er eine Selbstverletzung schildert: „Ich zog die Scherbe über die andere Wange, diesmal jedoch so fest ich konnte … ich … nahm die Scherbe und ritzte zwei tiefe Schnitte neben die früheren …“ Diese Schilderung scheint mir übertrieben. Tiefe Schnitte, die die gesamte Haut durchtrennen, müssten Narben hinterlassen haben; davon ist im Gesicht des Autors jedoch nichts zu erkennen. So lappt nun die Fiktion in die Wirklichkeit hinein.Eine weitere Stelle in demselben Band schildert detailliert eine Geburt, schweigt aber über die Nachgeburt und stört damit das Empfinden von Authentizität empfindlich. Schließlich denke ich an den knalligen Schluss des Bandes Leben. Da fickt er (ein anderes Verb wäre nicht angemessen) ein Mädchen von hinten, während sie sich, den Kopf aus dem Zelt streckend, übergibt. Geschehen oder nicht, das ist zu schön hässlich, um wahr zu sein, denke ich.
So ist das eben mit den literarischen Wahrheiten, sie entstehen in den Köpfen der Leser. Entscheidend dafür ist auch nach Knausgård nicht, ob etwas tatsächlich geschehen ist, sondern ob wir es glauben. Es mag sein, dass das Festhalten an wirklich Geschehenem, an einem Leben, das wir (aus derselben Generation westlicher Menschen) mühelos als das unsere wiedererkennen, den Sog des Authentischen vergrößert, es mag sogar sein, obwohl es ein bisschen magisch klingt, dass das Festhalten an Klarnamen die Authentizität vergrößert (in jedem Fall ist es publizistisch aufgegangen, all die aufgebrachten Menschen, die sich in Norwegen um ihr Privatleben betrogen sahen, haben hübsch zur Glaubwürdigkeit des Romans beigetragen). Das Geschehen lässt sich aber ebenso als eine sehr gut gemachte Fiktion lesen, ganz ohne darüber zu philosophieren, ob es eine absolute Realität überhaupt gibt und ob sie woanders sein kann als im Augenblick. In dem Fall ginge es beim knausgårdschen Erzählen um eine Neukalibrierung dessen, was glaubwürdige Fiktionen ausmacht. Diesen Gedanken greift der Autor wie so Vieles im letzten Band an mehreren Stellen selbst auf, nur wendet er ihn polemisch und behauptet, über eine Wirklichkeit zu schreiben, die ihrerseits an keiner Stelle infrage steht, sondern als gesetzt gilt. Die größte Prägnanz weist vielleicht folgende Passage auf:
„Die Grundidee meiner Romanreihe lautete schließlich, die Wirklichkeit zu schildern, wie sie war. Eine Jugend, geprägt von ihm, der da wohnte und dies tat, von ihr, die da wohnte und das tat …, aber nicht in das Leichentuch der Literatur gehüllt, nicht kunstfertig ausgeleuchtet im abgedunkelten Studio der Prosa, sondern in hellem Tageslicht beschrieben, von Wirklichkeit umhüllt. Ich wollte versuchen, zum Rohen und Willkürlichen dieser Realität vorzudringen …“ An anderer Stelle heißt es etwas nebulös: „Ein Roman, der etwas Wahres über die Wirklichkeit sagen wollte, durfte nicht zu einfach sein, er musste in seiner Kommunikation ein Element von Exklusivität haben …“
Manchmal spürt man auch eine regelrechte Wut gegen die meiste herkömmliche Literatur, einmal nach außen gerichtet gegen die Bücher anderer Autoren, ein andermal gegen das eigene Schreiben vor Min kamp, bei dem er angeblich Wochen damit zubringen konnte zu schildern, wie jemand einen Koffer vom Gepäckband nimmt, das Ergebnis aber selbst unglaubwürdig findet. Die Literatur ist (oder war bis zu ihm) für Knausgård in einer Glaubwürdigkeitskrise, der es mit einem neuen Ansatz zu begegnen galt. In dieser Hinsicht erinnert er an Nathalie Sarraute, die in den 1950ern detailliert darlegte, warum die Literatur des neunzehnten Jahrhunderts ihre Relevanz verloren hätte.
Geschichte der Engel
Bleiben wir noch einen Moment bei der Idee des Authentischen. Vor Min kamp schrieb Knausgård den Roman Alles hat seine Zeit. Darin erzählt er, grob gesagt, die Geschichte der Engel von der Schöpfung bis in die Gegenwart. Er erfindet einen frühneuzeitlichen Engelsforscher, Antinous Bellori, der sich vor allem mit den biblischen Erscheinungen der Engel befasst, gleichzeitig aber persönliche Begegnungen mit Engeln hat und versucht, die Autorität des biblischen Textes mit seiner eigenen Erfahrung in Einklang zu bringen. Dieser Roman erzählt in weiten Teilen die Geschichte von Kain und Abel wieder, außerdem diejenige der Sintflut, allerdings in einer norwegischen und zwar vormodernen, aber historisch bewusst inkorrekt dargestellten Gesellschaft. Der Erzähler dieses kontramythischen Romans behauptet, damit das authentische Setting zu schildern. Die Menschen der nachsintflutlichen Epoche, die in einer heißen und unwirtlichen Welt gelandet seien, hätten die vorsintflutlichen Erzählungen einfach ihrer Normalität, ihrer Lebenswelt angepasst, „all die Fichten, all die Fjorde und Berge, aller Schnee und Regen, alle Luchse und Bären, Wölfe und Elche“ seien im Nachhinein verschwunden. Vom Beginn dieses Buches möchte ich ebenfalls eine längere Passage zitieren:
„Selbst wenn es einem gelänge, seine [Belloris] innere Landschaft zu dokumentieren, wie sie wirklich war, bis in die kleinste Spalte und Furche seines Charakters hinein, und merklich geformt von der langsamen Erosion der Begebenheiten, und man den Lauf der Gefühlsströme bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgen würde, Erlebnissen in der Kindheit, der Jugend oder dem Mannesalter, so würde man trotz allem nicht klüger werden, da die Bedeutung des Dokumentierten doch stets unbekannt bliebe. Selbst wenn die Ereignisse und Beziehungen in seinem Leben bis ins Detail mit einem Leben in unserer Zeit zusammenfielen, das wir verstehen und kennen, würden wir ihm doch niemals näher kommen. Antinous war in erster Linie ein Teil seiner Zeit. Will man verstehen, wer er war, ist sie es, die man untersuchen muss … unsere Welt ist nur eine von vielen möglichen, woran uns nicht zuletzt die Schriften eines Antinous Bellori und seiner Zeitgenossen erinnern.“
Zwei Aspekte machen den Seitenblick auf den früheren Roman interessant. Zum einen scheint Knausgård hier geradezu das Gegenteil über Authentizität zu behaupten wie in Min kamp. Jemanden bis in seine kleinsten Regungen und mit dem gesamten Archiv seiner Gefühle zu kennen, führe gerade nicht zur Authentizität. Jede Epoche sei sicher, „dass gerade sie den Normalfall verkörpert, dass gerade dies der eigentliche Zustand der Dinge ist.“ Deshalb komme es darauf an, die Zeit, also den größeren Zusammenhang zu durchleuchten, in dem jemand lebt, um ihn zu verstehen.“ In Min kamp heißt es dagegen: „Also musste ich mich ducken, um unter den Ideologien wegzutauchen, gegen die man sich nur verteidigen kann, indem man auf seinem eigenen Erleben der Wirklichkeit beharrt und es nicht verneint, denn das tun wir die ganze Zeit … und nirgends war die Täuschung des Ichs, des Einzigartigen und Partikulären, größer als in der Kunst …“ Der Akzent hat sich eindeutig zum Individuellen verschoben – auch wenn die Ideologiefreiheit dieser Perspektive bezweifelt werden darf.
Es stimmt, dass Knausgård auch ansetzt, unsere Gegenwart zu durchleuchten. Dies geschieht aber ebenso auf der Ebene des Individuellen und recht eigentlich des Ästhetischen. Wenn KOK feststellt, dass unsere Zeit übervoll von Fiktionen sei, was sich an der Überpräsenz der Fiktionen verbreitenden Fernsehschirme zeige, dann zieht er daraus die Konsequenz, dass „der Romancier“ keine weiteren Fiktionen schreiben dürfe. Seltsam ist, dass er nicht darauf eingeht, wie sich durch die Massenmedien auch die (angebliche?) Realität immer stärker ausbreitet in zahllosen Dokus und Reportagen, Nachrichtensendungen, Talkshows, Reality-TV-Formaten, um beim genannten Medium zu bleiben.
Knausgård ist meines Erachtens ein Thesen-Aufsteller; es geht in seiner Literatur vor allem darum, Positionen auszuprobieren, die um der literarischen Wirkung willen apodiktisch formuliert sind, ohne unbedingt durchdacht worden zu sein. Das wäre zugleich das einzige Argument, das man für das zum Teil schwer erträgliche Dozieren über alles und jeden im letzten Band anführen könnte. Hier, besonders in den essayistischen Passagen, wechseln lichte Momente, die eher einem Fragen denn einem Antworten gleichen, mit farblosen, durch nichts gestützten Statements ab; KOK räsoniert. Ich gebe ein Beispiel:
„Wenn ich Intimität und alle Formen von Gefühlsausbrüchen verabscheue und mich in allen Beziehungen, die ich eingegangen bin, früher oder später auf das Neutrale, Zurückhaltende, Abgeklärte zurückgezogen habe, ist diese Abscheu dann nicht eigentlich ein Symptom dafür, dass eine Vater- oder Mutterbeziehung schiefgegangen ist? Nein, ich verabscheue Intimität und Gefühlsausbrüche, weil ich Intimität und Gefühlsausbrüche verabscheue, ich will es nicht … Nur die sexuelle Begierde verdrängt das Bedürfnis nach Grenzen und Distanz …“
Da kann ich nur nicken – oder den Kopf schütteln. In diesen Passagen erinnert KOK mich an jene Typen, die immer alle Platten aller Bands kannten und alles, was man lesen musste, schon drauf hatten. Mein Freud Adlr, der über gute Kontakte in die norwegische Literaturszene verfügt, vertraute mir übrigens an, Karl Ove Knausgård sei gar nicht Karl Ove Knausgård. Als erster Autor der Welt lasse er sich doubeln, da er sich aufgrund seines zerschnittenen Gesichts und seines hohen Körpergewichts (er habe es in Wirklichkeit nie geschafft abzunehmen) öffentlich nicht zeigen wolle. Der Knausgård, den wir von den Fotos, den Lesungen, den Interviews kennten, sei Yngve, der ältere Bruder des Autors. So erkläre sich mancher Widerspruch. Karl Ove Knausgård sei ein Nerd, zu nichts zu gebrauchen als vierzehn Stunden am Tag vor dem Rechner zu sitzen und Seite um Seite zu schreiben. Übrigens sei er halber Österreicher, daher das Verschweigen des Vaternamens und die vielen Verweise auf Bachmann, Bernhard, Broch, Handke und Hitler.
Lebendiges, Totes, Liebes
Lassen wir es bei diesen neidgetriebenen Fantasien bewenden. Ich möchte jedoch nicht vom Verhältnis zwischen Fiktion und Wirklichkeit bei KOK lassen, ohne das Perspektiv (genau, ein monokulares Fernrohr) noch einmal umzudrehen. Denn durch die Fiktion einer Wahrheit, dem anderen, das Min kamp erschaffen hat, und das nun in die Wirklichkeit gewisser Menschen in Norwegen und Schweden hineinlappt, geschieht, wie ich glaube, noch etwas anderes. In einer seiner Betrachtungen über das eigene Schreiben sagt KOK: „In Wahrheit gibt es so etwas wie das Soziale nicht, nur einzelne Menschen, unser Du, auch auf der Seite des Individuums. Tonje [seine erste Frau, um die es in dem Roman auch geht] ist keine ,Figur‘. Sie ist Tonje …“
Der Autor reflektiert in dieser Passage seinen Regelbruch, die Rücksichtslosigkeit, mit der er – im Zusammenhang seines eigenen Lebens – das Leben der anderen öffentlich ausbreitet. Mir scheint jedoch, dass er mit der Behauptung, Tonje sei keine literarische Figur, falsch liegt. Für die Mehrzahl seiner Leser kann sie nichts anderes sein, denn sie erschaffen Tonje reinweg in ihrer Fantasie, auch wenn der Stoff ihnen fester gewebt erscheinen mag, sobald er Kettfäden wie „Norwegen“, „meine Generation“, „wirklich geschehen“ usw. enthält.
In Wahrheit webt er damit an der immer stärker werdenden Matrix, jener groben Vereinfachung, die wir uns aktuell als Realität auftischen lassen. In dieser Matrix gibt es nichts Unverständliches, keine Paradoxa, weder Tiefe noch Geheimnis. Sie drängt die schmerzhaften Aspekte des Lebens ab, sie gibt uns eine Fantasie des Geordnetseins, des Gerichtetseins, in der das eigentliche Chaos, der primäre Wahnsinn, in dem unser Bewusstsein gründet, zu einem harmlosen, nicht nennenswerten Rest zusammenschrumpft. Nur um diesen Preis kann der Satz aus dem Klappentext zu Sterben gelten, der behauptet, jeder Mensch sei „ein einmaliger und unerschöpflicher innerer Kosmos.“ Die Welt des KOK ist zu Teilen die eines neubürgerlichen common sense. Knausgård lesen ist wie in einen Spiegel schauen, in dem unser Bild bereits gemalt und festgelegt ist. Ebenso nimmt der Transfer wirklicher Personen in den Text ihnen das Leben, sie werden zu Schatten, nicht mehr zurückzuholen aus dem Totenreich der Fiktion. Dieses schwer zu belegende Gefühl beschlich mich im Lauf der Lektüre, der Eindruck einer Übergriffigkeit, eines Angriffs auf die Lebendigkeit auch von Erinnerung.
Es ist nicht so, dass Knausgård die Wirklichkeit schildern könnte, wie sie ist, und das ist ihm auch bewusst. Doch er lehnt die Fiktionalisierung, die in der Erschaffung einer eigenen, von unserer Lebenswirklichkeit gelösten, wenn auch über die Bedeutung mit ihr verbundenen Welt ab. Diese Welt empfindet er als unwahr. Seine dagegen wirkt zeitweise untot. All die Urteile über andere, die Festschreibungen von Charakteren und die Erinnerungen an sie bilden einen Teil der großen Matrix. Aber sie breiten auf ihre Art das Leichentuch der Literatur über die Lebenswirklichkeit aus. Deshalb wehren sich die Betroffenen, sie wollen die Versteinerung dessen, was sie geworden und wie sie es geworden sind, und vor allem dessen, was sie darstellen, nicht akzeptieren, sie wollen weiter darüber verfügen. Alles hat seine Zeit drückt Beunruhigung aus bei dem Gedanken, dass auch die „Vergangenheit nicht abgeschlossen ist, dass auch sie sich verändert, als gäbe es in Wahrheit nur eine Zeit für alles.“
In der großen Schilderung seiner Familie, der Lovestory mit seiner Frau Linda und der immer wieder versuchten zärtlichen Hinwendung an seine Kinder scheint eine andere Möglichkeit des Erzählens auf. Hier hebt einer den Blick und schaut weniger urteilend denn fragend. Nur so kann das Lebendige gewahrt bleiben.
In seiner rätselhaften Meditation über den Orpheus-Mythos (Der Blick des Orpheus), über die KOK selbst in Träumen nachdenkt, versucht Maurice Blanchot das, was sich entzieht, in Worte zu fassen, ihm wenigstens nachzujagen – ein großartiger Versuch über das Geheimnis des Schöpferischen. Blanchot spricht unter anderem von der Übertretung und der Sorglosigkeit, die zum kreativen Prozess gehören. Der Essay ließe sich in Teilen wie eine Programmschrift zu dem lesen, was Knausgård mit Min kamp versucht hat. Genau in diesen Passagen jedoch, in denen es um seine psychisch kranke Frau Linda und seine kleinen Kinder geht (die sich zu dem, was Knausgård über sie schreibt, nicht verhalten können, die es vorerst nicht einmal lesen können), verlässt ihn die Sorglosigkeit und er beginnt, Rücksicht zu nehmen. „Ich weiß, dass die Geschichte des vorigen Sommers … sich in Wahrheit ganz anders abgespielt hat. Warum? Weil Linda ein Mensch ist, und das Wesentliche an ihr lässt sich nicht beschreiben.“ Etwas weiter vorn in Kämpfen steht über seinen Roman zu lesen: „Hätte ich ihn noch schmerzhafter werden lassen, wäre er noch wahrer geworden. Es war ein Experiment und es ist missglückt“, aber „es ist nicht wertlos.“
Keine Träume
Ein bisschen wahrer, ob das geht? Nach all den Kämpfen, die das 20. Jahrhundert für die volle Wahrheit focht, nach all den Versuchen, den ganzen Menschen, mit seiner Verdrängung, seiner Sexualität und seinem Weltraum an Unbewusstem sichtbar zu machen, folgt nun das. Es wird niemanden überraschen, dass KOK Freud nicht folgt, dass es in Min kamp keine Träume gibt (denken wir dagegen zurück an Henry Miller!) und Sexualität salopp als überbewertet gilt und damit in den Büchern einen vergleichsweise geringen Stellenwert erhält. Das ist die Gegenwart.
In einem Interview mit dem Deutschlandfunk Kultur bestätigt Knausgård, er habe das Schlimmste weggelassen. Doch hier macht er eine interessante Ergänzung: „Jetzt … kann ich das, was ich ausgespart habe, in eine fiktive Gestalt gießen. Ich kann einen fiktiven Roman schreiben und da all diese Erlebnisse hineinflechten …“ In Kämpfen hieß es noch, „wenn es so ist, dass alles entweder Fiktion ist oder als Fiktion gesehen wird, kann die Aufgabe des Romanciers nicht länger darin bestehen, weitere Fiktionen zu schreiben.“ Das ist schlicht falsch. Denn zum einen bedeutet Fiktion Lebendigkeit, Offenheit, Fragen statt Zuschreiben. Darin enthalten ist: Respekt. Zum anderen hat Knausgård aber auch mit Min kamp ein Werk der Fiktion geschaffen, das den tradierten Mustern des fiktionalen Erzählens folgt, das am stärksten ist, wenn es die alten Motive des Erzählens – Vaterhass, Bruderzwist, Paarliebe – wieder aufnimmt, wenn es mit anderen Worten (auch) mythisch wird.
In einer seiner schönsten Passagen über das Schreiben setzt KOK sich mit Peter Handkes Wunschlosem Unglück auseinander. Er beschreibt, wie Handke nach dem Wahren sucht, indem er seine Mutter nicht präsentiert, sondern ihr Bild aus dem „gesamtgesellschaftlichen Sprachfundus“ entstehen lässt. Handke sei der „Respekt vor ihrer [der Mutter] Integrität besonders wichtig gewesen. Sein eigenes Verfahren beim Schreiben über den Tod des Vaters findet Knausgård dem diametral entgegengesetzt: „Ständig setze ich Gefühle, Affekte und das Sentimentale ein, das Gegenteil des Rationalen, ich dramatisiere meinen Vater und stelle ihn als einen Charakter in einer Erzählung dar; ich präsentiere ihn so, wie man fiktive Charaktere präsentiert, indem ich das ,als ob‘, das sämtliche Literatur betonte, verbarg und ihn und seine Integrität auf grundlegende Weise verletzte, indem ich sagte, so war er.“ Knausgård verbindet das mit der Behauptung, er habe ausschließlich in diesem Fall keinerlei Rücksicht genommen. Es ist also der Tote, der nicht mehr von der Seite des wirklichen Lebens her Einspruch erheben kann, dem der größte Affront gilt. Wieder verwickeln sich die Ebenen des Lebendigen und des Toten, der Realität und der Fiktion; eines ragt in das andere hinein.
Knausgårds Sixpack bewegt sich zwischen zwei Polen – (lebendiger) Liebe und Tod. Klassischer geht es eigentlich nicht. Was er vorsätzlich nicht tun will, tut er eingestandenermaßen doch fortwährend: er verwandelt, er schafft eine Version der Wirklichkeit, die manchmal an eine Landlust-Welt erinnert, Dörfer ohne Brennnesseln und Kuhscheiße, einen Sehnsuchtsraum, den wir nicht mal mehr wirklich betreten wollen und viel lieber als Vintage-Vision vorblenden. Andererseits schafft sie in ihrer gedanklichen Sprunghaftigkeit und manchmal Widersprüchlichkeit, in ihrer zärtlichen Zuwendung zum Detail und groben Missachtung von Wegseh-Geboten vielleicht doch eine eigene Matrix. Mehrfach wurde dem Norweger der Satz von Max Frisch entgegengehalten, er (Frisch respektive Gantenbein) probiere Geschichten an wie Kleider. Aber dazu sollte man ergänzen, was Frisch bereits 1975 in Montauk schrieb: „… der kleine Ort, wo er gestern beschlossen hat, dieses Wochenende zu erzählen: autobiographisch, ja, autobiographisch. Ohne Personnagen zu erfinden, die exemplarischer sind als seine Wirklichkeit; ohne auszuweichen in Erfindungen … ohne Botschaft.“ Kurz darauf fällt der große Satz, er (Frisch) habe sich in seinen Geschichten entblößt „bis zur Unkenntlichkeit“. Max Frisch ist dabei konzise und treffsicher auf das Wesentliche beschränkt; er braucht den Wald von Stützen nicht, die den knausgårdschen Romandampfer umgeben, als würde er noch auf der Helling liegen.
Neuartige Beschreibungskunst
Seit jeher bebt die Literatur unter den Fortschritten der Gesellschaft. Die Empfindsamen spürten das wie die Romantiker, die Realisten wie die Naturalisten. Sicher bleiben Fragen, etwa: wie man in dieser Ästhetik eigentlich von sich selbst absehen kann oder was mit der Künstlichkeit werden soll. Womöglich zeigen sich bei Knausgård im Ganzen schon Umrisse einer neuartigen Beschreibungskunst, obwohl das Buch in keinem seiner Teile neu ist. Am schmerzlichsten fehlt vielleicht das Gefühl, sich im Anderen erkennen zu können, sich selbst beim Lesen zu verlieren und am Ende doch bei sich selbst zu landen. So gesehen hat Min kamp etwas von einem Selfie.
In mein Tagebuch schrieb ich im Augst 2015: „den ersten knausgård zu ende gelesen. er wird mal den nobelpreis kriegen. den titel ‚min kamp‘ hat er nicht zufällig gewählt, sondern weil er den bildungsroman eines mannes schildert, der eine art literarischer weltherrschaft (≈ weltruhm) anstrebt. darüber wäre nachzudenken. in der erzählung ist er meistens gut, mir manchmal zu bestimmt auftretend, meistens genau und glaubwürdig. hie und da ist der zuschnitt der szene zu stark dramaturgischen überlegungen unterworfen. manchmal tickt er zu sehr das triviale an, zu explizit, sollte ich sagen. an dieser stelle lässt die suggestion des authentischen nach, ich fange an mich zu fragen, was davon eigentlich erfunden ist. – und natürlich ist alles erfunden. es scheint dann, dass der grund für die ganze ausschlachtung der eigenen biografie hauptsächlich der ist, ein maximum an glaubwürdigkeit zu gewinnen. sodass die moderne sich am ende selbst aufisst. danach müsste eine andere art des erzählens kommen …“
Die Moderne isst sich selbst auf; ihre Kinder fressen die Postmoderne. An vielen Stellen und auf ganz unterschiedliche Arten wird spürbar, dass die Nachkriegsepoche mit ihren aus unglaublichen Katastrophen gewonnenen Maximen vorbei ist und mit ihr eine bestimmte Art des Schreibens. Das erzeugt einen andersartigen Zugriff auf die Welt, bedeutet aber nicht das Ende der Fiktion. Es geht darum, literarische Glaubwürdigkeit zu behalten oder wiederzuerlangen. Es kann nicht darum gehen, erzählerische Spielräume einzuengen. Karl Ove Knausgård zeigt sich der Welt als das schöne Gesicht der postliberalen Literatur.