Es geschieht nicht oft, dass die Literaturwelt, oder zumindest der Literaturbetrieb, so beharrlich nach Basel blickt wie in diesem Juni. Der Anlass: Dem Schriftsteller Alain Claude Sulzer wurde ein behördliches Schriftstück mit merkwürdigem Inhalt zugestellt. Absender: Der Fachausschuss Literatur beider Basel (siehe Abbildung unten).
Sulzer hatte im März dieses Jahres um einen Werkbeitrag für die Arbeit an einem Roman angesucht, der „Genienovelle“ heißen soll und im Deutschland der 1960er- und 1970er-Jahre spielt. In dem Schreiben wird Sulzer beschieden, dass der Fachausschuss sein Gesuch „sorgfältig geprüft“ und „eingehend besprochen“ habe, das Gesuch aber nicht abschließend beurteilen könne und daher um die Nachreichung einer Stellungnahme ersuche. Er möge seine Überlegungen bei der Verwendung des Wortes „Zigeuner“ darlegen, das laut Duden diskriminierend sei, außerdem sei zu erklären, welche Relevanz das stereotyp beschriebene Wohnumfeld des Protagonisten im Gesamtprojekt haben werde.
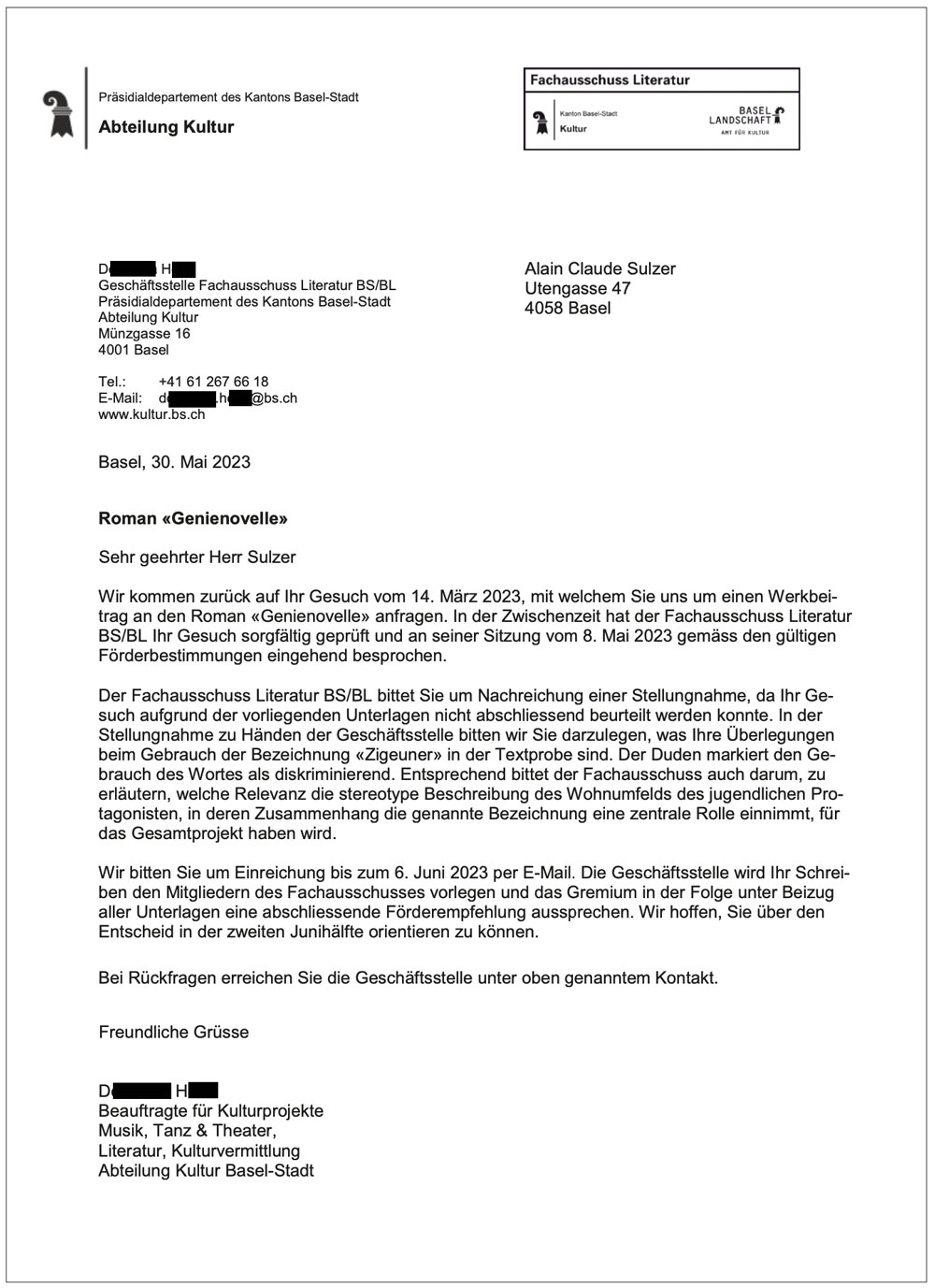
Sulzer, Jahrgang 1953, Autor von rund fünfzehn Büchern, mehrfach mit Literaturpreisen ausgezeichnet, Übersetzer von Julien Green und Juror beim Ingeborg-Bachmann-Preis, war einigermaßen konsterniert, dass die anonyme Fachjury es für angebracht hielt, ihn wie einen Schuljungen über die Konnotation des Wortes „Zigeuner“ zu belehren. Zudem musste jedem literarisch halbwegs versierten Leser klar sein, welche Funktion das Wort im Kontext des eingereichten Textes hatte. Ein Ich-Erzähler in den 60er-Jahren in Bochum verwendet nicht den Ausdruck „Sinti und Roma“. Was also sollte die Frage?
Sulzer sah in dem Vorgang den Versuch einer Zensur: „Ich würde das Geld ja bekommen, wenn ich die Szene streiche.“ Eine Stellungnahme kam für ihn nicht infrage. Er zog das Gesuch zurück und machte den Brief des Fachausschusses öffentlich. Die NZZ berichtete über den Fall, die Süddeutsche Zeitung, die FAZ und zahlreiche weitere Medien zogen nach. Das Gros der Kommentare gab dem Autor tendenziell recht. Um Zensur im engeren Sinne handle es sich zwar eher nicht, um einen Angriff auf die Literatur und die Freiheit der Kunst aber allemal.
Bizarre Wendung
Eine überraschende und leicht bizarre Wendung nahm der Fall, nachdem mit Bettina Spoerri und Dana Grigorcea zwei Mitglieder des Fachausschusses an die Öffentlichkeit gegangen waren und bekannt gegeben hatten, von dem ominösen Schreiben an Sulzer überhaupt nichts gewusst zu haben. Der Fachausschuss habe Sulzers Romanvorhaben zur Förderung empfohlen!
Wie sich in der Folge herausstellte, hatte nicht der Fachausschuss zum Duden gegriffen und eine Stellungnahme eingefordert, sondern Katrin Grögel, die Leiterin der Abteilung Kultur des Basler Präsidialdepartments. Sie hatte das Schreiben hinter dem Rücken der Fachausschussmitglieder, aber gleichwohl in deren Namen verschickt und den Autor somit über die Urheberschaft des Briefes getäuscht. Während einer Podiumsdiskussion mit Sulzer nannte sie dies später einen „Fehler“ – allerdings nur in der Kommunikation. In der Sache habe sie nichts falsch gemacht, die Nachfrage rechtfertigt sie mit der Sorgfaltspflicht, die sie habe, vor allem, wenn das Amt „Gelder spricht“. Zum Amtsverständnis generell meinte sie: „Wir sind Wächterinnen übergeordneter Regelungen.“
Warum nun fand der Fall so viel Beachtung über die Grenzen von Basel hinaus? Wer mit dem Literaturbetrieb nicht vertraut ist, wird sich schwertun zu verstehen, dass die Angelegenheit Süddeutsche und FAZ auf den Plan ruft und PEN-Präsidentin Eva Menasse öffentlich den Rücktritt von Frau Grögel fordert.
Der Grund liegt in der weit verbreiteten Verunsicherung unter Autorinnen und Autoren, die sich durch reale oder auch nur imaginierte Sprachregelungen gegängelt und in ihren Ausdrucksmöglichkeiten eingeschränkt fühlen. Im Dickicht der hypertrophierenden identitätspolitischen Sensibilitäten ist es unmöglich, sich zu bewegen, ohne eine der neuen, sich zudem stets verschiebenden sprachlichen Anstandsgrenzen zu übertreten. Jeder ist bereits schuldig geworden, man hat ihn nur zufällig noch nicht entlarvt.
Das verleiht den Wächterinnen der übergeordneten Regelung ihre Macht – die Macht der reinen Willkür. Jeder kann jederzeit seine Nachfrage vom Fachausschuss zugestellt bekommen und das Amt wird mit seinen Zweifeln gegenüber dem Skribenten immer im Recht sein.
Frau Grögels Schreiben ist nicht die von selbstloser Sorgfaltspflichterfüllung geleitete harmlose Nachfrage, als die sie von ihr dargestellt wird. Sie behauptet damit etwas. Sie behauptet, dass Alain Claude Sulzer über den Verdacht des Rassismus nicht erhaben ist. Dass Sulzer einer ist, bei dem man in diesen Dingen schon genau nachfragen muss! Ab sofort ist Sulzer nicht mehr Sulzer, sondern ein unter Rassismus-Verdacht stehender Autor, sogar der Fachausschuss musste ihm deswegen schon schreiben! Wir wissen: In der social media-Gesellschaft ist der Verdacht die Anklage, der Vorwurf das Urteil und der Prozess zu Ende, bevor die ersten Zeugen gehört wurden.
Kommen wir zurück auf die Frage der Zensur. Hier ist Sulzer nicht zu helfen, er liegt hoffnungslos daneben. Die Wächterin braucht keine Zensur. Ihr stehen längst die besseren, minimalinvasiven Herrschaftstechniken des nanny states zur Verfügung: nudging, framing, deplatforming, shadowban et cetera. Wenn es doch mal robust sein muss: mindfuck und psyop. (Grögels false flag-Operation, die Nachfrage im Namen des Fachausschusses zu stellen, fällt in diese letzte Kategorie). Zensur ist so 20th century.
So weit, so klar. Aber was sollte eigentlich das Ganze? Was will die Wächterin? In wessen Namen, zu wessen Vorteil übt sie ihre Herrschaft aus? Cui bono? Die Frage führt – zu nichts. Der Literaturbetrieb ist ein autopoietisches System, das sich selbst perfektioniert. Der Zweck des Systems ist der Erhalt des Systems. Akteure gibt es nur scheinbar. Sie sind, wie die „Fahrer“ in den vollautomatisierten U-Bahn-Zügen, nur an Bord, damit die Fahrgäste nicht nervös werden.
Der evolutionären Logik des Systems entspricht es, dass à la longue aussortiert wird, was nicht funktioniert. Das gilt, zum Beispiel, für das Phänomen der Zensur. Sie konnte das Entstehen starker, unbotmäßiger Literatur letztlich nicht verhindern. Metternich ist ebenso gescheitert wie Stalin. Jetzt ist Grögel dran. Das ist ein Fortschritt und wirklich für alle besser so.
Das System hat, wie gesagt, kein Ziel außerhalb seiner selbst, aber die Bedingungen seiner Selbsterhaltung erzeugen eine Drift. Die optimale Überlebensstrategie besteht nämlich darin, nicht wahrgenommen zu werden. Wer nicht wahrgenommen werden kann, hat keine Fressfeinde. Das Herunterdimmen aller Lebensimpulse auf das absolute Minimum, das de facto-Unsichtbarwerden für die Welt außerhalb des Systems gibt die Richtung der Entwicklung vor. Das literarische System ist auf diesem Weg weit fortgeschritten.
Der optimal stabile Zustand, auf den die Literatur sich systemisch zubewegt, ist daher einer, in dem sie gerade noch nicht tot ist – Stichwort „Selbsterhaltung“, siehe oben –, aber trotzdem keine Verwirrung mehr stiften kann mit schlimmen Wörtern: Das künstliche Koma. Es ist für alle besser so! Auch Sulzer wird letztlich ein Einsehen haben müssen, die Regelung ist eine übergeordnete.
Die Literatur sanft in diesen Zustand hinüberzugeleiten ist die Aufgabe des Amtes, das die Gelder spricht. Und am Bett der komatösen Patientin steht sie – die Wächterin, mit dem Duden in der Hand.
