
Laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung handelt es sich bei Peter Truschner um einen Vertreter „jener aussterbenden Künstlerspezies, die stets aufs Ganze gehen muss“. Und in der Tat ist dieser 1967 in Kärnten geborenen Autor, Fotograf, Essayist und Dramatiker, der seit 1999 in Berlin lebt und sich in unterschiedlichen Sparten und theoretischen Kunstdiskursen bewegt, nicht leicht zu fassen. Bekannt wurde Truschner mit seinen bei Zsolnay erschienenen Romanen Schlangenkind, Die Träumer und Das fünfunddreißigste Jahr, parallel dazu verfasste er Libretti und Theaterstücke. Er war Regieassistent bei Martin Kusej und hatte eine Dozentur an der Universität der Künste in Berlin inne. Vor einigen Jahren wandte sich Truschner vor allem der Fotografie zu, etwa mit dem Text- und Fotoband Bangkok Struggle für den er einige Monate in den Hinterhöfen des „Arbeitslagers Asien“ lebte und dort den Überlebenskampf in den Vierteln der Händlerinnen, Handwerker und Arbeiter dokumentierte. Es folgte das Fotoprojekt She stood there a Loaded Gun, in dem er mit dem Model Anna Petzer verschiedene Facetten einer komplexen weiblichen Persona auslotete und den Fotografien Gedichte von Emily Dickinson beistellte. Vergangenes Jahr erschien Truschners Essayband Die Maske abgenommen. Künstler und Modell im 21. Jahrhundert bei Vittorio Klostermann. Im Moment schließt Truschner gerade ein neues Fotobuch und einen Roman ab.
STEFAN GMÜNDER: Sie sitzen gerade über den finalen Korrekturen ihres nächsten Romans. Soviel ich weiß, haben Sie schon 2014 damit begonnen?
PETER TRUSCHNER: Stimmt, ich war längere Zeit schwerer erkrankt, der Text kam mir darüber regelrecht abhanden. Außerdem gibt es beim Schreiben bei mir eine heikle Phase: Ich habe mich an ein mögliches Ende herangetastet, und wenn ich das letzte noch fehlende Teil finde, ist der Text fertig. Bei mir breitet sich ab diesem Zeitpunkt ein gewisses Desinteresse am Text aus. Ich habe festgestellt, dass mich die Energie, die im Aufbrechen und bei der darauffolgenden Arbeit ins Offene frei wird, per se immer mehr angezogen hat als das Ankommen. Diese Einstellung lässt sich auf meine gesamte künstlerische Arbeit übertragen. Im Schreiben habe ich mich nach der Prosa dem Theater, der Oper und dem Essay zugewandt. Dazu kam parallel die Fotografie, zuerst auf der Straße, danach im Studio.
GMÜNDER: Ihr literarisches Debüt heißt Schlangenkind. In der Tat wird man den Eindruck nicht los, dass Häutung ein wichtiges Wort für Sie und Ihr Werk ist.
TRUSCHNER: Man kann schon sagen, dass das programmatisch für die Art ist, wie ich an meine Arbeit herangehe. Immer wieder eine neue Haut auszuprägen, mich in anderen Kontexten und Formaten noch mal neu kennenzulernen. Die Kunst ist für mich dabei weniger ein zu erlernendes Handwerk, auch wenn das Lernen so, wie ich vorgehe, nie aufhört. Sie ist vielmehr eins mit meiner Lebensführung. „Extimität“ nennt Lacan dieses ineinander Übergehen von Externem und Intimem.
Konventionell inszenierte Schönheit kann unglaublich öde sein. Etwa beim einst sehr erfolgreichen „Pirelli-Kalender“, wo bedeutungsschwanger dreinblickende Frauen in einer Vulkanlandschaft nackt in Pumps herumstehen, und keiner weiß, warum.
GMÜNDER: Hat Ihnen die Vielseitigkeit im Kunstbetrieb eher genützt oder geschadet?
TRUSCHNER: Vielseitigkeit ist nicht erwünscht. Der Kunstbetrieb ist so spezialisiert wie andere Berufszweige auch. Verlage, Theater und Galerien wollen zuverlässig beliefert werden. Man soll zu einer Marke mit Wiedererkennungswert werden. Bestenfalls, dass es zu Synergieeffekten kommen kann wie bei Sibylle Berg, die Prosa und Stücke schreibt. Da bleibt es aber wenigstens beim Text. Wenn man jedoch zwischen den Künsten wechselt, hat man nur Schwierigkeiten. Ich habe kaum Leute im Betrieb gefunden, die das bereichernd finden. Natürlich auch, weil Spezialisten viel über den eigenen Bereich, aber nur wenig über andere wissen. Das verunsichert dann.
GMÜNDER: Dazu muss man aber auch sagen, dass Sie kein Kind von Traurigkeit sind, in Ihren Artikeln und Texten beziehen Sie streitbar Stellung und bieten Anlass zu Diskussionen.
TRUSCHNER: Ich habe eine gewisse Freude an Scharmützeln und Spektakeln, die ich durch Dinge, die ich mache oder schreibe, immer wieder hervorzurufen in der Lage bin. Eine Seite von mir ist extrovertiert genug, um daran Vergnügen zu finden. Aber über meine eigentliche künstlerische Arbeit tausche ich mich nur mit wenigen aus. Ich habe schon immer darauf geachtet, dass nicht alle alles von mir mitbekommen, dass ich einen großen Spielraum habe, mich frei zu bewegen, nicht festgelegt zu werden.

GMÜNDER: Das hört sich jetzt aber arg harmlos an, immerhin üben Sie in ihrer Kolumne „Fotolot“ auf Perlentaucher regelmäßig scharfe Kritik an Betriebsgrößen und etablierten Institutionen.
TRUSCHNER: In den vergangenen drei Jahren habe ich das „Fotolot“ zur meist gelesenen deutschsprachigen Online-Kolumne über Gegenwartsfotografie gemacht – auch, weil ich präzis benenne, was andere in ihrem Umfeld nur schwer aussprechen können. Die ausgeprägte Verseilschaftung des Kulturbetriebs und der Rekurs auf Zeitgeistnarrative machen es vielen schwer, ohne Rücksichtnahme auf herrschende Empfindlichkeiten und die eigene Karriere zu sagen, was sie wirklich denken, und nur das zu machen, was sie für angebracht halten. Man kann sagen: Die autonome, freie Kunst erlebt gerade eine Krise. Ebenso wie das Individuum in Zeiten aktueller Identitätspolitiken, die zwingend über Gruppenzugehörigkeit funktionieren. Künstlerisches Handeln ist heute für den Nachwuchs mit so vielen Auflagen verbunden, es gilt so viele „Must Have’s“ und „No Go’s“ zu beachten, aussagekräftige Referenzen zu sammeln und sich dabei auch noch selbst zu vermarkten, dass es sehr schwer ist, nachhaltig zu sich selbst zu finden. Aber nur dann findet man auch zur Kunst, und zwar in einer Weise, die unabhängig macht von ökonomischem Erfolg, der Meinung der anderen und der Angst, zu scheitern.
GMÜNDER: Neben dem Roman haben Sie parallel an Ihrem neuen Fotobuch She stood there a loaded Gun und am Essay Die Maske abgenommen. Künstler und Modell im 21. Jahrhundert gearbeitet. Der Essay, in dem Sie ebenso auf eigene Erfahrungen zurückgreifen wie auf theoretische Schriften, ist letztes Jahr erschienen. Kann man sagen, dass es darin – auch – um den fragwürdig gewordenen männlichen Blick auf den nackten weiblichen Körper geht?
TRUSCHNER: Siebenundvierzig Jahre ist Laura Mulveys einflussreicher Essay zum „Male Gaze“ inzwischen schon wieder alt. Es ist wichtig, über die historischen Implikationen dieses Blicks Bescheid zu wissen, wenn man als Künstler mit Frauen arbeitet, die sich vor der Kamera ausziehen. Weshalb mein Buch auch historische Abrisse zur Geschlechterpolitik beinhaltet – man kann im Jahr 2022 davor nicht die Augen verschließen. Der gesellschaftliche Kampfplatz weiblicher Körper, weibliche Schönheit und Sexualität bleibt im Hintergrund präsent, auch wenn sich das dann im Laufe der Zusammenarbeit verliert, da die Individualität des Gegenübers stärker zum Ausdruck kommt.
GMÜNDER: Das heißt?
TRUSCHNER: Wenn ein Gegenüber in der Situation ankommt, von sich aus zu experimentieren beginnt, Risiken eingeht und Dinge zum Vorschein kommen, die für das Gegenüber selbst überraschend sind, beginnt der künstlerisch interessante Bereich – erst recht, wenn man, wie ich, der Arbeit gegenüber dem Ergebnis den Vorzug gibt. Es ist immer das Besondere, sprichwörtlich Eigentümliche, das interessant ist. Alles andere ist oft nur begabte Knipserei. Schon die Frauenfiguren meiner Romane sind komplex und ambivalent. Ich habe ein starkes Interesse am Sich-Zeigen eines facettenreichen Subjekts, erst recht durch die Nacktheit hindurch, was definitiv nicht einfach ist.
GMÜNDER: Die Konstellation Künstlerin und männliches Modell schein eher selten, oder täuscht das?
TRUSCHNER: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Frauen vom weiblichen Körper ebenso besessen sind wie Männer, weshalb Frauen, die sich selbst oder andere Frauen fotografieren, deutlich in der Überzahl sind. Frauen sind historisch so sehr auf ihren Körper festgelegt worden, dass der weibliche Körper und die weibliche Sexualität allein vom diskursiven Standpunkt her viel mehr Anschlussmöglichkeiten bieten als der heterosexuelle männliche Körper. Der musste bei der Arbeit und im Krieg funktionieren und einen Erben liefern, mehr war im Grunde nicht.
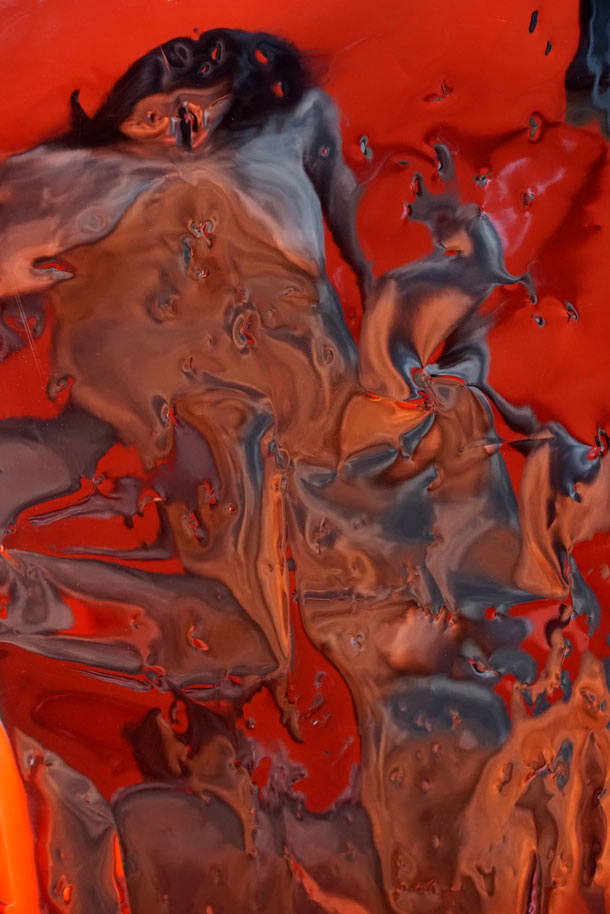
GMÜNDER: Sie beschreiben in Ihrem Essay eine eigentümliche Dialektik zwischen Oberfläche und Tiefe, unter dem, was man zu sehen glaubt, befindet sich jede Menge Unsichtbares.
TRUSCHNER: Die Oberfläche ist das Sichtbare, auf das es mal mehr, mal weniger nahe liegende, wenn nicht kalkulierbare Reaktionen gibt. Das führt oft zu einem eindimensionalen Ergebnis. Menschen wollen gut aussehen, stark und souverän wirken, das ist das grundlegende Bedürfnis. Die professionelle Fotografie ist davon abhängig, dass die Leute mit dem Ergebnis zufrieden sind. Das hat aber mit Kunst nichts zu tun. Konventionell inszenierte Schönheit kann unglaublich öde sein. Etwa beim einst sehr erfolgreichen „Pirelli-Kalender“, wo bedeutungsschwanger dreinblickende Frauen in einer Vulkanlandschaft nackt in Pumps herumstehen, und keiner weiß, warum. Es müssen sich in der Arbeit Bruchsituationen ergeben, wo auf den Menschen, dem dieser nackte Körper angehört, Rückschlüsse möglich scheinen: auf seine Gefühle, seine inneren Konflikte, seine Vergangenheit. Günstigsten Falls erzählt das Gegenüber von allein über sich, dann beginnt die wirklich spannende, aber auch gefährliche Zeit eines Projekts. Manchmal kann das Gegenüber hinterher das Gefühl haben, es habe zu viel von sich preisgegeben.
GMÜNDER: Das also meinen Sie mit der abgenommenen Maske?
TRUSCHNER: Rilke hat gesagt, Rodin habe dem nackten Körper die Maske des Gesichts abgenommen, weil sich im Gesicht die Persönlichkeit zeigt. Wobei es nicht nur ein physisches, sondern auch ein gesellschaftliches Gesicht gibt, ein öffentliches und ein privates, das man zu wahren versucht. Ein Gesicht gibt oft einen ersten Hinweis darauf, ob etwas nicht stimmt, ob man sich unwohl fühlt oder erregt ist. Wenn man das beiseite schiebt und auf den nackten Körper fokussiert, wo gefühlt die Proportionen oft nicht idealtypisch stimmen – der eine fühlt sich zu klein, die andere zu groß, der eine zu dick, die andere zu dünn –, dann ist das Gegenüber auf seinen Körper festgenagelt. Das ist auch der Grund, warum auf Plattformen wie Instagram so ein Wahn herrscht, was die Darstellung von Gesichtern und Körpern betrifft. In diesen Medien im falschen Moment abgelichtet zu werden, mit unvorteilhaftem Ausdruck, erst recht nackt, ist ein absolutes No-Go. „Body Positivity“ ist in diesem Zusammenhang eine begrüßenswerte Bewegung, aber künstlerisch leider irrelevant, da Zweck und Inhalt dabei ebenso determiniert sind wie beim „Pirelli“-Kalender. Ist ein Statement von Beginn an das Ziel, beraubt man sich wichtiger Momente künstlerischen Handelns wie Widersprüchlichkeit und Vieldeutigkeit
GMÜNDER: Könnte man sagen, dass die heutige Zeit trotz aller Explizität auf eine andere Weise prüde ist?
TRUSCHNER: So wie die Prüderie und die Schamgrenzen früher vor allem religiöse Wurzeln hatten, haben sie heute etwas mit dem kapitalistischen Zwang zur Selbstoptimierung zu tun, den nicht wenige verinnerlicht haben. Nur das Bild zu zeigen, das von Vorteil erscheint, nur nicht auf ablehnende Kommentare stoßen. Glatt, unverdächtig, erfolgreich. Wenn auf der anderen Seite eine Influencerin ihren Super-Hintern in Endlos-Schleife zeigt, geht das in Ordnung, denn die harte Arbeit, die darin steckt, und das Geld, das sie dann damit verdient, folgen der Logik kapitalistischer Wertsteigerung.
GMÜNDER: Ein Backlash also?
TRUSCHNER: Eher ein Fortschritt in puncto Überwachungsgesellschaft. Man ist erfolgreich, wie Byung Chul Han in Anlehnung an Hegel sagt, wenn man das Arbeitslager in sich trägt, wenn man zugleich sein eigener Gefangener und Wärter ist. Viele sind, wenn sie sich im öffentlichen Raum bewegen, gefühlt immer online. Das heißt, sie sind in einer Art und Weise potenziell sichtbar, dass eine Kamera oder ein Smartphone Bilder von ihnen machen und sie danach im Internet verteilen könnte, auf die sie jeden Moment gefasst sein müssen. Was unterschwellig einen Druck erzeugt und zugleich eine Selbstverständlichkeit mit sich bringt, überwacht zu werden, weil man die Überwachung schon verinnerlicht hat. Die Verwirklichung des Benthamschen Gefängnisses nicht nur im Raum, sondern auch in der Zeit.
Die ruinierten afrikanischen Viehzüchter interessieren niemand, weder in der EU-Kommission noch im Postkolonialismus-Seminar in Cambridge. Mit Achille Mbembe am Trinity College über Die Verdammten dieser Erde zu parlieren, ist da ungleich attraktiver.
GMÜNDER: Wenn man der Theorie glaubt, sollte sich die Kunst kritisch mit den jeweiligen Herrschaftsverhältnissen auseinandersetzen?
TRUSCHNER: Zur aktuellen Neofeudalisierung der Kunst gehört zwingend ihre Feigenblattfunktion fürs herrschende System. Wenn ein Format wie das Stadttheater, das in unseren Breitengraden politisch völlig irrelevant ist, proklamiert, wir arbeiten unseren Sexismus und Rassismus auf, dann wäre das in Zeiten, als das Establishment noch reaktionär war und bleierne Verhältnisse herrschten, ein Aufreger gewesen. Heute dient so ein Pseudo-Aktivismus einer globalisierten Ökonomie und einer Politik, die ihr den Steigbügel hält, als Feigenblatt. Von der Kluft zwischen dem Gehalt eines Intendanten und einer jungen Schauspielerin ganz zu schweigen – sie ist politisch befördert und steht symbolisch für die größer werdende Kluft zwischen Reich und Arm. Während vordergründig Solidarität mit #blacklivesmatter zelebriert wird, gibt es eine EU-Landwirtschaftspolitik, die die hiesigen Milchbauern an den Rand der Verzweiflung bringt, weil sie Überschüsse produzieren müssen, von denen sie kaum leben können, damit Firmen wie Nestlé und Danone diese Überschüsse zu preislich unschlagbarem Milchpulver verarbeiten und exportieren können, was dann in Ländern Afrikas die Milchwirtschaft samt Viehzüchtern ruiniert. Diese Black Lives interessieren selbstverständlich niemand, weder in der EU-Kommission noch im Postkolonialismus-Seminar in Cambridge. Mit Achille Mbembe an einem sonnigen Tag im schönen Innenhof des Trinity College über Die Verdammten dieser Erde zu parlieren, ist da ungleich attraktiver.
Sie könnten die Direktionen der Wiener Staatsoper, der Berliner Schaubühne, des Städelmuseums Frankfurt, des Deutschen Literaturinstituts Leipzig und so weiter mit einem Schlag entlassen – der Schaden für die Kunst läge ziemlich genau bei null.
GMÜNDER: Sie meinen also, die Gegenwartskunst sei bigott?
TRUSCHNER: Die Kunst nicht, aber der Kulturbetrieb. Die Kunst ist nie identisch mit ihrem Betrieb und dessen Personal gewesen. Das Publikum und der künstlerische Nachwuchs sollen das nur glauben. Sie könnten die Direktionen der Wiener Staatsoper, der Berliner Schaubühne, des Städelmuseums Frankfurt, des Deutschen Literaturinstituts Leipzig und so weiter mit einem Schlag entlassen und die Läden bis auf weiteres schließen – der Schaden für die Kunst läge ziemlich genau bei null. Als Betrieb war die Kunst so gut wie immer feudal. Während der Fürst in seiner Prachtvilla in der Stadt den neuesten Tizian präsentiert hat, hat er am Land in einem Verließ seine politischen Gegner gefoltert, und alle wussten das.
GMÜNDER: Und heute?
TRUSCHNER: Das meiste Geld, das in den letzten dreißig Jahren in den internationalen Kunstbetrieb geschleust wurde, kommt wie im Fußball außer von den üblichen Verdächtigen im Westen von Superreichen aus Asien, Südamerika und der arabischen Halbinsel, die davon leben, Ressourcen nicht selten auf Kosten anderer auszubeuten. Natürlich muss man, um diese schmutzigen Betriebsverhältnisse zu kaschieren, sich Narrative aneignen, die die Leute glauben lassen, in der Tate Gallery oder im MoMA ginge es um Menschenrechte oder gesellschaftlichen Wandel. Es gilt dabei dasselbe wie für die deutsche und österreichische Staatskultur: Personen werden ausgetauscht, Geschlechter langsam gleichgestellt, dazu angesagte Narrative samt stillschweigend akzeptierten Sprechverboten und -geboten installiert – aber die Machtverhältnisse und Verteilungsstrukturen dahinter bleiben weitgehend dieselben. Alles schaut ganz neu aus wie die „Tagesschau“-Sprecherin mit familiären Wurzeln in Syrien – und bleibt im Kern doch so, wie es immer war, nicht anders als bei Konzernen wie Amazon, wenn sie Bilder glücklicher People of Color in ihre Werbung einspeisen, die aber dann als Paketboten aufgrund des Profitdrucks unterwegs in Plastikflaschen pinkeln müssen.
GMÜNDER: Wäre es übertrieben, zu sagen, dass Ihr Blick stets auch ein soziologischer ist?
TRUSCHNER: Ich habe mich immer gern als Emphatiker gesehen, aber mein Interesse an kleinsten und feinsten Lebensäußerungen, die durch Gesten oder Worte entstehen können, bewirkt, dass ich vom gewissermaßen Dionysischen schließlich abweiche und ins Mikrosoziologische übergehe. Im Detail ahnt man das Ganze, in scheinbar Nebensächlichem und Peripherem. Letztlich hat Bourdieu eine ganze Gesellschaftstheorie auf den feinen Unterschieden aufgebaut. Mit ein Grund, warum etwa Mrs. Dalloway von Virginia Woolf zu meinen Lieblingsbüchern gehört, in dem alles – Erinnerungen, Polsterbezüge, Handschuhe, Blicke, Blumen, Vorhänge, Tränen – miteinander verwoben ist, in Beziehung steht.
In der Corona-Zeit ist zudem offensichtlich geworden, wie wenig große Teile der hiesigen Staats-Kunst den Leuten fehlen. Verständlicherweise.
GMÜNDER: Ja, die feinen Unterschiede. Andererseits hat man den Eindruck, dass heute der Anpassungsdruck an den Mainstream größer geworden ist?
TRUSCHNER: In ihrer Studie kommt Carolin Amlinger zum erwartbaren Ergebnis, dass bei Künstlern und Künstlerinnen am Ende weniger das Talent als die „soziale Passung“ zum Erfolg führt. Nicht zu heftig, nicht zu rechts, nicht zu links, nicht zu experimentell, nicht zu erotisch – alles nicht „zu“. Oder wie der Bühnenbildner Bert Neumann einmal sagte: „Geil soll es sein und irgendwie anders – aber stören darf es nicht“. Der deutschsprachige Kulturbetrieb ist dementsprechend vom Hautgout der Harmlosigkeit durchdrungen. In der Corona-Zeit ist zudem offensichtlich geworden, wie wenig große Teile der hiesigen Staats-Kunst den Leuten fehlen. Verständlicherweise. Schließlich ist bei uns ist so gut wie alles „Midcult“, wie das Moritz Baßler nennt, eben jene Harmlosigkeit, die perfekt zur Passivität der Merkel-Jahre passte, in denen eine Generation von Erben einfach gehofft hat, dass sie mit Mutti und einer Decke über dem Kopf gut durch die Zeitläufte kommt.
Die Bücher und Stücke, die bei uns zu wirklich „heißen“ Komplexen wie Rechtsextremismus, Rassismus, Islamismus, Migration oder allgegenwärtiger Korruption geschrieben werden, sind viel zu harmlos.
GMÜNDER: Kommen wir zum Schluss noch mal zu Ihrem neuen Roman.
TRUSCHNER: Er spielt im Polizisten- und Soldatenmilieu, handelt unter anderem von traumatisierten Afghanistan-Rückkehrern, rechten Chatgruppen, Demonstrationen, illegalen Schießständen, Verhaftungen. Aber auch von unter diesen Umständen schwieriger Liebe. Kurz: es geht um aktuelle Dinge. Ich bin davon überzeugt, dass man als Künstler in der Verantwortung steht, sich nicht nur in der Gegenwart anzusiedeln, sondern in ihren wunden Stellen herumzustochern. Die Bücher und Stücke, die bei uns zu wirklich „heißen“ Komplexen wie Rechtsextremismus, Rassismus, Islamismus, Migration oder allgegenwärtiger Korruption geschrieben werden, sind viel zu harmlos. Man scheut davor zurück, in Romanen, am Theater und im Fernsehen wirklich schlimme, heftige, dazu ambivalente Dinge auf eine forciert künstlerische Weise zu verhandeln, bei der eventuell nicht sofort klar wird, was heute ganz wichtig ist: dass alle sofort erkennen, dass man selbstverständlich auf der richtigen Seite steht.
In der Literatur gibt es wie überall natürlich Ausnahmen. Sie werden jedoch immer seltener von großen Verlagen publiziert und sind in ihrer Substanz durch das um sich greifende Sensitivity Reading bedroht.
GMÜNDER: Sie denken, Bücher und Stücke dieser Art gibt es nicht mehr?
TRUSCHNER: Film, Museum und Stadttheater sind in Bezug auf ihr innovatives Potenzial dank herrschender Kulturpolitik so gut wie tot. Die Literatur hat gesellschaftlich massiv an Bedeutung eingebüßt und ist darüber zu einer Kuschelveranstaltung verkommen, in der es um Studienplätze, Stipendien, Preise und um eine Anbiederung an angesagte Narrative unter dem Einfluss des „Sensitivity Reading“ geht. Viele bedeutende Werke wurden erst lange nach ihrem Erscheinen (wieder-)entdeckt, Das Schloss oder Moby Dick. Woyzeck wurde fünfundsiebzig Jahre nach Büchners Tod zum ersten Mal aufgeführt – aber nur, weil der Literatur eine Deutungshoheit in Bezug auf ihre Zeit zugestanden und nach ihr gesucht wurde. Angesichts heutiger Zustände wird es später wohl nur wenige Wissenschafter geben, die glauben, dass es ausgerechnet im deutschsprachigen Raum Leute gab, die abseits des Betriebs für das Verständnis ihrer Zeit geradezu Unverzichtbares geleistet haben, dass akribisch danach zu suchen sich lohnen würde.
Die künstlerische Literatur ist bei uns zu einer Beschäftigung für Insider geworden, in der es zuerst um Studienplätze und Stipendien, danach um Preise, Dozenturen und ein gedeihliches Einvernehmen mit dem geht, was vom Feuilleton übrig ist.
GMÜNDER: Welche Auswirkungen werden der aktuelle Krieg und eine mögliche Rezession für die Kunst haben?
TRUSCHNER: Deutschland und Österreich sind Länder, die geprägt sind von der Besitzstandswahrung und der Angst vor Wohlstandsverlust. Wenn das Szenario dahingehend bedrohlicher wird, werden die meisten alles tun, um nachhaltig an den (Förder-)Trögen zu verbleiben oder dahin zu gelangen und dabei alles unterlassen, was sich in irgendeiner Weise als nachteilig für die Karriere erweisen könnte. Das Motto hiesiger Staatskünstler lautet seit jeher ohnehin nicht „Freiheit der Kunst“, sondern „Ran an den Speck“. Wer geglaubt hat, noch biedermeierlicher kann es hinter der Maske des Aktivismus und des Wandels im Kulturbetrieb nicht zugehen, darf sich auf die nächsten Jahre freuen. Die autonome Kunst wird dabei wieder zum Feind aller: der ideologisch verkorksten Linken, der von Abstiegsängsten bewegten Mitte und der gewaltbereiten Rechten.
* * *
