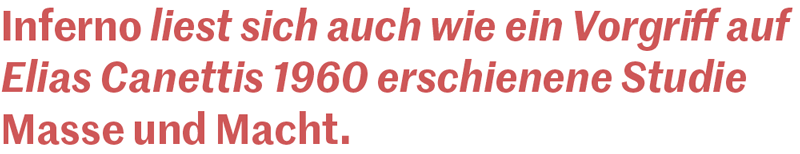Die Stenotypistin Aloisia Schmidt ist sich selbst und anderen ein apartes Rätsel. Aloisias Schöpferin Mela Hartwig erregte zur Blütezeit der Neuen Sachlichkeit beim allgemeinen Publikum wie bei Psychoanalytikern Aufsehen durch ihre kühnen Büroromane aus weiblicher Sicht. Fräulein Schmidts Erlebnisse mit wechselnden Dienststellen und Männern beschreibt Mela Hartwig in dem ihr eigenen nüchternen und im nächsten Moment fesselnden, fiebrigen Duktus. „Bin ich ein überflüssiger Mensch?“: Was für eine Frage, was für eine Anmaßung.
Dem Literaturverlag Droschl gebührt das Verdienst, seit 2001 mit der Veröffentlichung von Bin ich ein überflüssiger Mensch? Mela Hartwigs Werk wiederentdeckt und zugänglich gemacht zu haben. Bis 2004 wurden noch Das Weib ist ein Nichts und der Prosaband Das Verbrechen aus dem Nachlass publiziert. Er enthält neben Hartwigs Debüt Ekstasen auch die Novelle Das Wunder von Ulm, die Hartwig 1936 im Pariser Exilverlag Éditions du Phénix unterbringen konnte. Sie wählt eine mittelalterliche Szenerie, um hellsichtig zu beschreiben, wie das Judenviertel einer kleinen deutschen Stadt aufgrund eines angeblichen Hostiendiebstahls durch eine „furchtbare Feuersbrunst“ eingeäschert wird.
Dieser ernste, kaum verklausulierte politische Ton prägt auch Mela Hartwigs Roman Inferno, den sie nach dem Zweiten Weltkrieg verfasste und der jetzt zum ersten Mal erscheint. 1948, zehn Jahre nach der Emigration, war sie mit ihrem Mann Robert Spira zu Besuch in die alte Heimat Graz gekommen. Die Leute in der Steiermark hätten sich bei ihrem Anblick „geschreckt“, erinnerte sich der prominente Rechtsanwalt Spira im Rückblick. Nach dieser Enttäuschung kam für die jüdischen Emigranten eine Rückkehr aus dem Londoner Exil nicht in Frage. Dort reüssierte Hartwig unter ihrem Ehenamen Mela Spira als Malerin und starb 1967. Ihren letzten Roman Die andere Wirklichkeit konnte sie nicht mehr beenden, und auch das Manuskript von Inferno blieb unveröffentlicht.
Fulminanter Einstieg
Dabei hatte die Karriere der 1893 geborenen Wienerin so hoffnungsvoll begonnen: Sie debütierte als Schauspielerin, unter anderem am Berliner Schillertheater. 1927 prämierte Alfred Döblin ihre Novelle Das Verbrechen bei einem Wettbewerb der Zeitschrift Die literarische Welt – eigentlich ein fulminanter Einstieg. Die Zeitumstände jedoch versagten ihr den Erfolg. 1931 hatte sie das Manuskript von Bin ich ein überflüssiger Mensch? an den Zsolnay Verlag gesandt. Dessen Absage vom März 1933 war von vorauseilendem Gehorsam gegenüber dem nationalsozialistischen Deutschland geprägt: „Sie wissen, sehr verehrte gnädige Frau, dass das Weltbild des deutschen Lesepublikums und besonders der deutschen Frau heute ein anderes ist als die Lebensanschauung, die aus Ihrem Werk spricht.“
Kurz vor der Emigration war das Ehepaar enteignet worden, außerdem wurden Mela Hartwigs Gemälde vernichtet. Da erscheint es konsequent, dass sie eine enthusiastische Nachwuchsmalerin zur Heldin ihres Romans Inferno machte. Die Wienerin Ursula ist eine leidenschaftliche Beobachterin, ein absoluter Augenmensch: „Denn was sonst als Träume, fragte sie sich, hat das Leben für eine junge Person, die 18 ist, eben ihr Abitur abgelegt hat und Malerin werden will. Malerin werden muss, weil alles, was sie bewegt, sich für sie in Erschautes verwandelt, sich zu Farben entzündet, sich zur Gestalt verdichtet.“
Die Handlung setzt Mitte März 1938 unmittelbar nach dem sogenannten „Anschluss“ Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland ein. Mela Hartwig schrieb Inferno von 1946 bis 1948 und reflektierte darin ihre eigenen traumatischen Erlebnisse in ihrer Geburtsstadt Wien unmittelbar vor dem Anschluss.
Ausschläge ins Pathos
Ursula, ein Mädchen aus gutbürgerlichem Hause, hat gerade erfahren, dass sie den ersehnten Studienplatz an der Kunstakademie erhalten wird. Ihr Fürsprecher jedoch, ein bislang anerkannter Maler, ist unter den neuen Machthabern plötzlich verfemt. Die Wirklichkeit schlägt aus ideologischen Gründen Haken, und Mela Hartwig spiegelt dies in langen, vorwärtsdrängenden Satzperioden, die noch den Expressionismus atmen. Nicht von ungefähr trug ihr Debüt von 1928, ein Novellenband, den Titel Ekstasen und erregte Aufmerksamkeit bei Psychoanalytikern. Es sind diese jähen, fiebrigen Stimmungswechsel mit Ausschlägen ins Pathos, die Mela Hartwigs Prosa für heutige Leser zunächst gewöhnungsbedürftig, aber zugleich aufregend machen: „Sie erinnerte sich jetzt daran, bemerkt zu haben, dass in der Stadt eine ungemein festliche, ja geradezu trunkene Stimmung herrschte, der sie keine Beachtung geschenkt hatte, weil sie die ungewöhnlich erregte Bewegtheit des Straßenbildes und die Fahnen, die grell von allen Häusern flatterten, nur als Widerschein ihrer eigenen festlichen Stimmung erlebt hatte. Jetzt erst fiel ihr ein, dass die Stadt an eben diesem Tage den Einzug des Mannes feierte, an dessen Worten sich Abertausende so willig berauschten und von dem sie daher erwarteten, dass er Wunder tun konnte.“
Entfesselte Gewalt
Ursulas Bruder, der namenlos bleibt, schließt sich sogleich den Braunhemden an und dient sich dem Gauleiter an, während der Vater zögert und die Mutter still vor sich hin leidet. Die junge Frau selbst schwankt in ihren Ansichten, auch wenn sie sich vom martialischen Gebaren ihres Bruders abgestoßen fühlt. Sie verliebt sich in einen Kommilitonen, der sich wiederum dem Widerstand anschließt. Erst die Geschehnisse der Pogromnacht am 9. November 1938 lassen die Nichtjüdin den Ernst der Lage unwiderruflich erkennen. Wie ein Fanal erscheint der biblisch getönte Satz „Der Tempel brennt“ mehrfach in Versalien. Ursula erlebt diese Nacht der entfesselten staatlichen Gewalt als Abgrund, der sie von ihrem bisherigen Leben trennt.
Inferno inspiziere das innere Erleben des äußeren Schreckens, schreibt der Historiker Vojin Saša Vukadinović in seinem informativen, dabei recht pessimistischen Nachwort, was die aktuelle Hartwig-Rezeption betrifft. Diese innere Welt, heißt es im Buch, sei jedem gegeben, um die äußere ertragen zu können.
Durch ihren damals populären Vornamen wird Ursula zur prototypischen Zeitgenossin der 1930er-Jahre. Anhand ihrer Beobachtungen überführt Mela Hartwig Sigmund Freuds Theorie von der libidinösen Konstitution einer Masse beeindruckend, wenn nicht gar schwindelerregend in Prosa. Inferno liest sich aber auch wie ein Vorgriff auf Elias Canettis 1960 erschienene Studie Masse und Macht, etwa wenn sich die faschistischen Symbole durch die Verzückung des Publikums in Monster zu verwandeln scheinen: „Wie von einem unsichtbaren Pinsel auf gigantischer Leinwand festgebannt, erblickte sie unabsehbar Menschen, Männer und Frauen, Kinder und Greise, die dicht aneinandergedrängt und emporgehobenen Gesichts den Worten lauschten, die einer sprach, der hoch über ihnen auf lorbeerbekränztem Sockel stand, in eine blutrote Fahne gehüllt, von der sich dunkel ein unheimliches Zeichen abhob, ein Kreuz, dessen Enden sich drohend zu Haken verkrümmten.“
Kleinteiliger Sadismus
Ursula erlebt, wie sich der Alltag an der Kunstakademie immer stärker verändert. Ein Kommilitone begeht im Zeichensaal Selbstmord, um seiner Verhaftung zu entgehen. Ihr namenlos bleibender Geliebter erleidet im Caféhaus einen merkwürdigen Unfall, als ihm die Marmorplatte eines Tisches auf den Fuß fällt. Der Trümmerbruch erregt bei den Behörden Argwohn. Gegen den Künstler wird daraufhin wegen des Verdachts ermittelt, sich selbst verstümmelt zu haben, um sich der Einberufung zu entziehen. Denn inzwischen hat das Dritte Reich Polen überfallen – im Text die zweite entscheidende historische Marke nach der Pogromnacht. So springt die Handlung etwas unvermittelt in die quälend langen Monate vor Kriegsende. Ähnlich wie in Bertolt Brechts Drama Furcht und Elend des Dritten Reiches ist diese Phase von Hunger und dem kleinteiligen Sadismus der sogenannten Volksgenossen untereinander geprägt: „Damals entstanden jene von prophetischen Händen gemalten Plakate, die so ungeheures Aufsehen erregten und Hungerplakate genannt wurden, jene in Farben zersprengten Visionen der namenlosen Not, die als Strafgericht über ein blindes und verderbtes Volk hereinbrechen sollte, jene erschütternden Visionen, die warnend und beschwörend zum Aufruhr aufriefen. […] Wer vor einem solchen Plakat getroffen wurde, der wurde verhaftet. Wer es erblickte und nicht sofort Meldung erstattete, wurde verhaftet.“
Wie in Furcht und Elend des Dritten Reiches erlebt Ursulas Familie exemplarisch alle nur denkbaren Schicksalsschläge jener Zeit, eine „Flut aus Blut“. Einzig der Schrecken des Bombenkriegs bleibt ihr erspart: „Auch Ursula hörte den unheimlichen Warnungsruf der Sirene, aber nur zuweilen, denn noch wurde die Stadt, aus der steil der gothische Turm ihres geliebten, dem heiligen Stephan geweihten Domes emporstieg, geschont. […] Zwischen den Zeilen der Zeitungen brachen die Flammen hervor, die ferne Städte verheerten und verzehrten, die Worte, die das Radio hervorstieß, zerplatzten krachend, wie ferne Detonationen, und was Zeitungen und Radio verschwiegen, spiegelte sich in den aschgrauen, jäh verfallenen Gesichtern, die an ihr vorbeiglitten, wie ein Spuk.“
Ähnlich wie die Neurotikerin Aloisia Schmidt ist auch Ursula in einem Kokon aus Selbstbeobachtungen gefangen. Selbstbestätigung und -bezichtigung wechseln einander ab, flankiert von so mancher fast schon tragikomischer Ohnmacht. Diese ereilt Ursula prompt im Vorzimmer einer Nazi-Größe. Sie wollte sich bei dem als abstoßender Lustmolch karikierten Bonzen pro forma als Spitzel bewerben. Selbst in diesem scheinbar unpassenden Moment offenbart sich Mela Hartwigs sarkastische Komik, die bereits ihre frühen Werke rund um angebliche Hysterikerinnen in der modernen Angestelltenwelt kennzeichnet. Als ihre Heldin rund um die Uhr illegale Flugblätter verteilt, gibt das der Verfasserin Gelegenheit, über den Rhythmus kreativer Arbeit nachzudenken, „der, einem schweren Wellengang vergleichbar, die Kräfte in schwindelnde Höhen emporschnellt, wo sie sich schöpferisch entfalten, und sie in Tiefen der Verzweiflung hinabschleudert, wo sie sich in schmerzhafter Rast erneuern“. Das liest sich wie eine poetologische Selbstaussage von Mela Hartwig.
All diese Gegensätze und Plötzlichkeiten sorgen für ein stets bewegtes Erzählgeschehen und lockern damit den niederdrückenden Determinismus der historischen Ereignisse ein wenig auf. Mit der Erstveröffentlichung von Inferno siebzig Jahre nach Entstehen des Romans setzt der Droschl Verlag eine Art Schlussstein im Triumphbogen seiner Mela-Hartwig-Edition. Eine vergessene Autorin wird man sie nun endgültig nicht mehr nennen müssen.