Als ich das letzte Mal im Zweistromland zwischen East River und Hudson war, waren Eileen Myles und Isabelle Lehn bei mir. Naturgemäß war ich allein. Nein: Ich war einsam. Auch wenn der, dem ich entkommen wollte, bei mir war und im Flugzeug auf Platz 10B saß, genau wie ich.
Ich war damals auf der Suche nach Autofiktionen und bin es noch immer. In meinem Handgepäck hatte ich literarischen Seelenproviant dabei – Bücher, die manchmal Memoir und manchmal Autofiktion genannt wurden, aber auch Romane waren: Eileen Myles’ Chelsea Girls, das ich auf dem Flug zum zweiten Mal las, und Isabelle Lehns damals gerade erschienenes Frühlingserwachen, das ich auf dem Flug zum ersten Mal las. Die Bücher vermischten sich in mir, und in diesem Moment war ich glücklich, auch wenn ich zu Hause der Verlorene war und mir eimerweise Wein nachschenken ließ, weil ich Flugangst hatte.
Meine Enttäuschung galt am ehesten den deutschen Feuilletons und der Art, wie sie mit den Texten umgingen, die mir damals am meisten bedeuteten.
Ich war damals von Deutschland enttäuscht und bin es noch immer. Neben meinem Körper war mein Heimatland der Ort, an dem mir Schmerzen zugefügt wurden. Doch meine Enttäuschung galt zu diesem Zeitpunkt am ehesten den deutschen Feuilletons und der Art, wie sie mit den Texten umgingen, die mir damals am meisten bedeuteten. Meine Feuilleton-Frustration wurzelte in der unterbelichteten Weise, mit der man über Autofiktionen schrieb, erst ganz schnell alles autofiktional nannte und bald ebenso schnell wieder davon gelangweilt war. Immer störten mich drei Dinge. Erstens: Man machte zu viel aus dem autobiografischen Anteil der Autofiktion. Zweitens: Man machte zu viel aus dem fiktiven Anteil der Autofiktion. Obwohl die Gattungsbezeichnung Auto-Fiktion doch eigentlich unmissverständlich ein Doppelgenre bezeichnete. Und drittens: Aus der eigenen Autofiktion machten die Feuilleton-Funktionäre beim Schreiben von Autofiktionsfeuilletons rein gar nichts. Sie schrieben so, als gäbe es die Schreibenden, die sie waren, gar nicht. Vielleicht glaubte ich naiverweise, dass ein tief bewegendes Buch irgendeinen Rückstand im eigenen Wesen hinterlassen müsste, und dass man folglich sogar sein Denken, und vielleicht sein Schreiben, überdenken müsste, anders schreiben müsste. Vielleicht waren meine Erwartungen an die Literaturkritik zu hoch. Doch die Literaturkritik dieser Tage war mir meistens fad, weil sie so wenig kritisch und so wenig literarisch war. Manchmal schien es mir, als würde sie über alles lieber schreiben als über Literatur.

Foto: A. Sophron
Ich war schon lange auf der Suche nach einem neuen Zugang, nach einem neuen Schreiben über Autofiktionen. Was würde geschehen, wenn man die emotionalen Kontexte der eigenen Verfassung, so beschämend sie auch wären, in einem Text über ein literarisches Werk offenlegen würde, wenn man frei heraus sagen würde, mir ging es beschissen aus diesem oder jenem Grund, als ich dieses oder jenes Buch las, und es gewährte mir etwas Trost in meiner dunkelsten Stunde? Wäre es nicht aufschlussreich zu wissen, ob ein Verriss von einem zufriedenen Menschen oder einem verletzten Menschen geschrieben wurde? Und wäre es nicht zumindest interessant zu erfahren, an welchem Ort die glühende Rezension verfasst worden wäre, vor einem Fenster mit Sturm an einem Ort der Unruhe oder auf einem Balkon über einem blühenden Flieder in einer freien Stadt?
Ich wollte klaren Kontext und Ultra-Subjektivität, wo die Literaturkritik die affige Illusion aufrechterhielt, als schriebe sie von nirgendwo aus, als wäre sie erhaben objektiv und die Kritikerinnen und Kritiker nichts als körperlose Kritik-Automaten (was zugegeben für einige zutrifft, wenngleich aus anderen Gründen). Aber Literatur wird von Körpern gelesen, wie sie von Körpern geschrieben wird, und es erschien mir den größten Unterschied zu machen, ob ich ein Buch im Zustand der Verzweiflung las oder im Zustand der Verliebtheit.
Als ich im Ellis Island 2.0 – der Passkontrolle des Kennedy-Airports – auf meine Einreise-Erlaubnis wartete, kam mir die Idee, während meines Aufenthalts Eileen Myles ausfindig zu machen. Myles wohnte seit Jahren in Manhattan, und vielleicht bekäme ich ein Interview. Das Memoir Afterglow, über Myles’ Hündin Rosie, beginnt mit einem Brief der geliebten Rosie an die Autorin, und weil Briefe nur ankommen, wenn sie adressiert sind, ist dem ersten Kapitel eine Adresse auf der 40. Straße vorangestellt. Dort würde ich Eileen finden. Und bis dahin hatte ich die autofiktionale Eileen und die autofiktionale Isabelle bei mir.
Verweigerte Versöhnung
Was mich an den Büchern so bewegte, war die Art und Weise, wie die Erzählerinnen kleine und kleinste Momente ihres Lebens zum Anlass nehmen, mit sich selbst in Kontakt zu kommen, und das obwohl die Ich-Kommunikation mitunter die schwierigste ist. Myles erzählt ihr Chelsea Girls in Kurzvignetten, die mit einem realistischen, romanhaften Erzählen so viel zu tun haben wollen wie ich mit den Idioten aus meiner Schulzeit. Immer verweigert Myles im Erzählen die Versöhnung mit der schmerzenden Vergangenheit, ob sie davon erzählt, wie sie viel zu viele Drogen nimmt, viel zu wenig isst, wie ihr Vater viel zu viel trinkt, sie immer viel zu wenig Geld hat und allein auf die Literatur vertraut. Bis sie schließlich selbst die Literatur schrieb, die ich jetzt dort in der Hand hielt, wo sie verfasst worden war. Ich war bewegt, weil ich in dieser Literatur einen Ort fand, an dem ich jetzt und ganz egal in welcher Fremde zu Hause war, ganz egal wie verloren ich mich dort oder irgendwo fühlte. So wie Myles in Chelsea Girls schrieb: „Also richtete ich mich in meinen Gedichten ein und hielt mein Leben für das eines Verlierers, und damit eben auch für poetisch.“
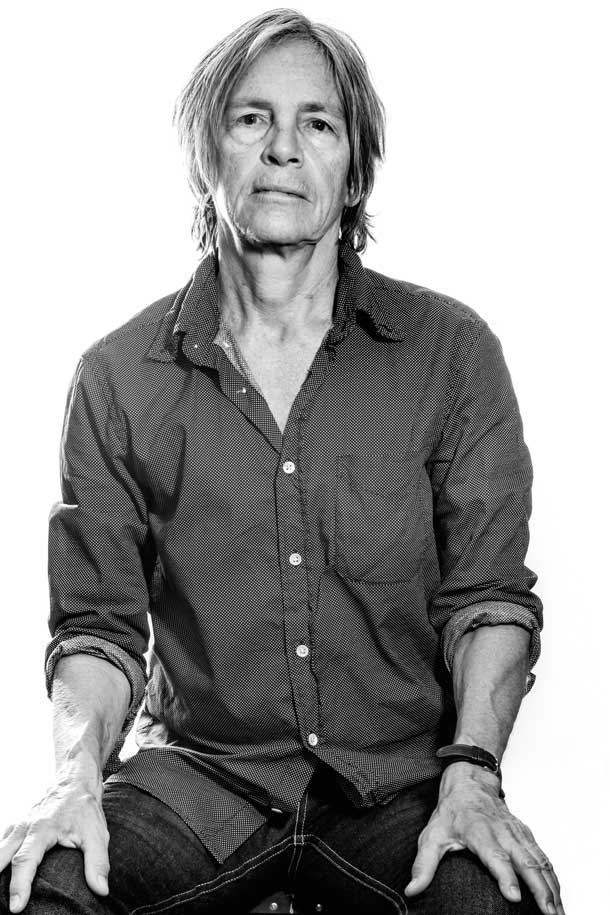
Foto: Shea Detar
Ich war bewegt, weil ich das etwas unanständige Gefühl hatte, dass Frühlingserwachen ebenso gut auch über mich hätte geschrieben sein können. Diese kindliche Naivität, mit der ich bis heute noch immer nicht begreifen will, wie es sein kann, dass ich lese, als schaute ich in einen Spiegel, einen Spiegel aus Papier, auf dem Buchstaben vor langer Zeit und an einem anderen Ort gerade so ausgestreut worden sein konnten, dass sie mir aus dem Herzen sprechen. Die Erzählerin Isabelle Lehn, die von ihrem Leben und Schreiben berichtet, stellt sich so häufig so sehr als einen Menschen an den Seitenrändern des Lebens dar, nachdenklich, melancholisch, rau, so einsam und so tief verloren, dass meine eigene Einsamkeit, meine eigene Verlorenheit sich aufzulösen scheinen, weil es uns beiden gleich geht. Sie schreibt: „Mein sicherer Ort ist eine Lücke im Bücherregal, in die ich mich hineinquetschen kann.“ Diese Lücke war für mich
Dieser Beitrag ist nur für Abonnenten zugänglich. Bitte melden Sie sich in Ihrem Konto an, oder wählen Sie eines der drei unten stehenden Abos, um sofort weiterzulesen.
Das erfolgreichste, weil intellektuell beweglichste Literaturblatt unserer Tage*
– für den Preis von einem Espresso im Monat.
Förder-Abo
€ 9,00 / Monat
(Mindestlaufzeit: 12 Monate)
- Zugang zu allen Online-Beiträgen
- Printausgabe (4 Hefte / Jahr)
- E-Paper-Ausgabe (4 Hefte / Jahr)
- 300+ Online-Beiträge / Jahr
- Online-Leseproben und Vorabdrucke
- Zugang zu E-Paper-Ausgaben im Archiv
- Zugang zu ca. 2000 Beiträgen im Archiv
- Tägliche Presseschau
- Newsletter
- Novitäten-Telegramm
- Preis-Telegramm
- Ausschreibungen
- Ausgewählte VOLLTEXT E-Books
- Ausgewählte VOLLTEXT Specials
Digital
€ 2,00 / Monat
(Mindestlaufzeit: 12 Monate)
- Zugang zu allen Online-Beiträgen
- E-Paper-Ausgabe (4 Hefte / Jahr)
- 300+ Online-Beiträge / Jahr
- Online-Leseproben und Vorabdrucke
- Zugang zu E-Paper-Ausgaben im Archiv
- Zugang zu ca. 2000 Beiträgen im Archiv
- Tägliche Presseschau
- Newsletter
- Novitäten-Telegramm
- Preis-Telegramm
- Ausschreibungen
Print & Digital
€ 3,00 / Monat
(Mindestlaufzeit: 12 Monate)
- Zugang zu allen Online-Beiträgen
- Printausgabe (4 Hefte / Jahr)
- E-Paper-Ausgabe (4 Hefte / Jahr)
- 300+ Online-Beiträge / Jahr
- Online-Leseproben und Vorabdrucke
- Zugang zu E-Paper-Ausgaben im Archiv
- Zugang zu ca. 2000 Beiträgen im Archiv
- Tägliche Presseschau
- Newsletter
- Novitäten-Telegramm
- Preis-Telegramm
- Ausschreibungen
* Saarländischer Rundfunk
FAQ
Wie kann ich ein VOLLTEXT-Abonnement verschenken?
Sie können alle VOLLTEXT-Abonnements befristet oder unbefristet verschenken. Die Mindestlaufzeit beträgt ein Jahr. Danach kann das Abonnement auslaufen oder wahlweise durch die Schenkenden oder die Beschenkten verlängert werden.
–> Bestellinformationen
Was sind E-Paper-Ausgaben?
E-Paper-Ausgaben entsprechen 1:1 der gedruckten Zeitschrift. Abonnenten erhalten nicht nur Zugriff auf die jeweils aktuelle Ausgabe, sondern auch auf ältere Hefte im Archiv (gegenwärtig alle Ausgaben seit 2016).
Gibt es Kündigungsfristen?
Nein, Sie können das Abonnement jederzeit formlos per E-Mail oder Post kündigen.
Ich bin bereits Abonnent der Printausgabe und möchte Zugang zu den Online-Beiträgen, wie komme ich dazu?
Wenn Sie bereits über ein Online-Konto auf Volltext.net verfügen, können Sie mit Ihrem bisherigen Passwort auf die Beiträge hinter der Paywall zugreifen.
Ich kann die heruntergeladenen E-Paper-Ausgaben nicht öffnen.
Die E-Paper-Ausgaben sind mit einem Passwort geschützt. Informationen zum Passwortschutz finden Sie nach der Anmeldung auf der Startseite Ihres Online-Kontos.
Wo finde ich mein Online-Konto?
Am oberen, rechten Rand des Bildschirms finden Sie einen Link „Mein Konto“, über den Sie sich einloggen können.
