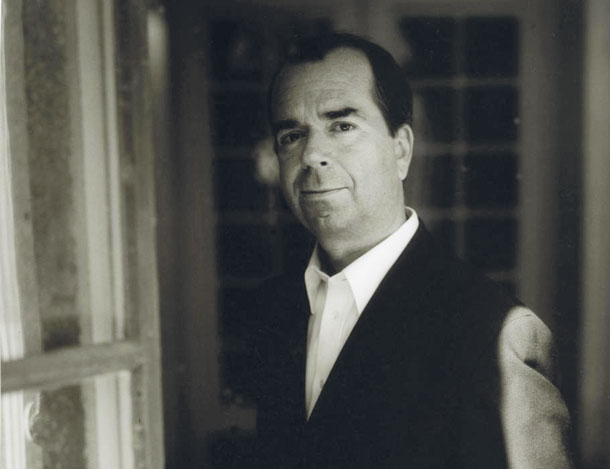
CAFÉ AGORA
Wir hätten unseren Bericht selbstverständlich auch hier beginnen können, da das Folgende, oder die Ereignisse, die als Ursache des nun Folgenden betrachtet werden können, in so vielen unseren Quellen zugrundeliegenden Erzählungen oder Erzählungsbruchstücken beschrieben, um nicht zu sagen, besungen wurden, dass sie den eigentlichen Kern der norwegischen Mentalität des 20. Jahrhunderts zu bilden scheinen. Den Spuren nach zu urteilen, muss die kleine Nation mehr als hundert Jahre gebraucht haben, um diese Erfahrungen zu verarbeiten.
Es war spät am Morgen, als Harald Keller, zumeist unter dem Namen Harald Bohre erwähnt, endlich erwachte und sich nach Sekunden der Verwirrung – die Tapete, das Bett, der Geruch – erinnerte, wo er war. Vorsichtig wand er sich unter dem Arm einer Frau heraus, die ihn auch noch im Schlaf umklammerte, und betrachtete die landkartenähnlichen Flecken auf dem Rollo. Er hatte Lust auf eine Zigarette, verzichtete aber. Er verspürte das Bedürfnis, sich zu waschen, hatte aber nicht die Kraft aufzustehen. Bis die Arbeit im Theatercaféen rief, sollte er lieber die Zeit nützen und an diesen weichen Körper angeschmiegt liegenbleiben, dachte er und kroch wieder zurück. Nicht dass er sich nicht darauf freute, Weste und Schürze anzulegen, Speisekarten auszuteilen, die Gesichter der Gäste zu studieren, wenn sie beim Lesen der Karte gleichsam vermittels der gefälligen Schrift in Gedanken von jedem Gericht kosteten; genauso wichtig aber war es ihm, so viel wie möglich über Betriebswirtschaft zu erfahren, denn am Ende jener Tage, die er wie an einer Schnur aufgereiht vor sich liegen sah, strahlte die Verwirklichung seines Traums, seines eigenen Café Agora. Harald Keller unterschied sich nicht von anderen Menschen. Die Nase in einen Frauennacken gebohrt, die Augen geschlossen, verschloss er die Augen gleichzeitig auch vor der Tatsache, dass jetzt jeden Tag das große Chaos ausbrechen konnte. Es war der 9. April 1940, und Harald Keller wurde, noch buchstäblicher als andere Norweger, von einem historischen Wendepunkt im Bett überrascht. Im Laufe einiger frenetischer Stunden sollte er ein warmes Bett mit einer schlafenden Frau darin gegen eine verschneite Böschung und ein Maschinengewehr im Anschlag tauschen.
Ein kurzes Frühstück, ein kurzer, leicht angestrengter Austausch von Phrasen, ein kurzer pflichtschuldiger Kuss, dann eilte er hinaus. Vergangenen Abend noch war sie ein Gast gewesen, eine Frau, die ihn angestarrt, ihm Blicke zugeworfen hatte, die ihm nur zu gut bekannt waren, und nach der Sperrstunde war er mit zu ihr nach Hause gegangen. Sie war jung, gutaussehend, Witwe. Vielleicht hatte sie ihm auch ein wenig leidgetan. Sie war Künstlerin. Vielleicht eine mit Zukunft, vielleicht auch nicht. Es war nicht das erste Mal, dass sie sich an ihn rangemacht hatte, aber erst am vergangenen Abend hatte er nachgegeben. Er war nicht stolz darauf, und es war erst das zweite Mal, dass er sich auf so eine Geschichte eingelassen hatte. Fast wie zum Trost hatte er bei dieser gebieterischen, selbstsicheren Frau Zuflucht gesucht, womöglich konnte er durch sie dieses ganze Schlamassel mit Maud vergessen. Nach der missglückten Feier bei Mutter war er noch stärker in eine Art Gleichgültigkeit hineingeschlittert, hatte den Zufall regieren lassen. Das lange Schlafen war nicht nur auf Erschöpfung zurückzuführen, sondern ebenso sehr auf die Schwermut, die über ihn hereingebrochen war. Er wollte in Schlaf fallen, erst durch einen Wangenkuss von Maud wieder geweckt werden.
Es war später Vormittag, und als er auf die Kongens gate hinaustrat und sein kleines Zimmer in der Pilestredet ansteuerte, merkte er, dass etwas anders war. Niemand lief schreiend umher, aber irgendetwas hatte sich verändert. Dann: Fliegergeräusche. Er schaute nach oben, und da kamen sie, hoch oben, nicht im Gleitflug, sondern im Sturzflug auf die Festung Akershus hinab. Sechs Flieger. Englische? Nein, es mussten deutsche sein. In einem dieser unverständlichen Seitenäste des Denkens kam es ihm in den Sinn, dass Sigurd gewusst hätte, um welche Flugzeugtypen es sich handelte, Messerschmitt, Heinkel oder Stuka, wie sie genannt wurden. Zuerst drei, dann noch drei, begleitet von einem infernalischen Heulen. Harald sah, er sah, zwei der Bomben durch die Luft fliegen. Ein kreischender Ton, abgelöst von einem gewaltigen Dröhnen, und noch einem. Sogar dort, wo er stand, konnte er den Luftdruck wie einen kräftigen Ruck im Körper spüren, und von dem Gebäude direkt hinter ihm fielen Dachziegel herunter. Vom Festungsplatz aus stieg Rauch in den Himmel. Eine der Bomben musste dort eingeschlagen haben. Aufgeschreckte Pferde galoppierten aus dem Stall, eines davon rutschte auf dem Kopfsteinpflaster aus und ging hässlich zu Boden. Harald musste sich an die Wand stützen, den Mauerverputz mit den Fingern befühlen. Es war, als wäre er in einer anderen Welt aufgewacht, in eine andere Welt hinausgetreten. An einen Ort, an dem – unmöglich zu fassen – Krieg herrschte. Er hielt einen älteren Mann auf der Straße an, packte ihn regelrecht am Jackenaufschlag. Was passierte hier? Da erfuhr er, dass die Deutschen Norwegen angegriffen hatten, nicht nur Oslo, sondern mehrere Küstenstädte. Der Mann, der über Haralds aufgeregte Ungläubigkeit erschrocken wirkte, teilte ihm mit, dass er es im Radio gehört habe.
Die Zeit ist aus den Fugen geraten, dachte Harald. Was mache ich jetzt?
Am Abend zuvor, direkt bevor sie das Theatercafeén verlassen hatten, war der Fliegeralarm mit seinem heiseren Geheul losgegangen. Weil der Alarm ständig zu hören war, und stets grundlos, hatten sie davon keine Notiz genommen. Es war eine kalte Aprilnacht und sie waren umschlungen durch verdunkelte Straßen geschlendert – auch das war zur Gewohnheit geworden, um Mitternacht wurde der Strom abgedreht. In der Wohnung der Frau hatten sie Kerzen angezündet und sich unter die Bettdecken gelegt. Er war in einer seltsam willenlosen Stimmung gewesen, hatte sich einfach treiben lassen in einem Spiel, bei dem sie leidenschaftlich die Führung übernommen hatte. Sie waren spät eingeschlafen, vielleicht hatte er mitten in der Nacht noch einmal Sirenen gehört, vielleicht sogar Flugzeuge frühmorgens, es konnte ein Traum gewesen sein, er hatte eine vage Erinnerung daran, dass die Frau, wie hieß sie nochmal, Wenche, gefragt hatte, ob sie das Radio aufdrehen solle, und dass er ein Nein gemurmelt hatte, das sei bloß eine Übung, Scheiße, wieso konnten sie nicht aufhören, die Leute mit diesen falschen Alarmen zu quälen. Aber jetzt? Echte Flieger und echte Bomben. Er begann zu laufen. Diese verdammten Nazischweine versuchten, Akershus zu zerstören! Das Erste, woran er dachte, war, dass er vor knapp zwei Monaten zusammen mit Maud dort gestanden hatte, direkt neben dem Festungsplatz. An einem Februartag bei leichtem Schneetreiben waren sie neben dem Haupteingang stehen geblieben und hatten sich über Tolstois Roman Anna Karenina unterhalten. Harald war krank vor Verliebtheit gewesen, und mit Schneeflocken in den Wimpern hatte Maud ihn mit einem intensiven Blick bedacht und erzählt, wie schockiert sie gewesen sei über die Stelle, wo Wronskij, kurz nachdem er endlich mit Anna vereint war und sie nach Italien reisten, sagte, dass er doch nicht glücklich sei. Das war es, was Harald am allermeisten mit Zorn erfüllte: Sie hatten die Stelle bombardiert, wo Maud Evensen mit Schneeflocken in den Wimpern gestanden und über die Liebe gesprochen hatte.
Er rennt am Parlamentsgebäude vorbei, erreicht die Karl Johan. Niemand scheint von Panik ergriffen, alles sieht aus wie immer, Menschen und Autos auf den Straßen. Was soll das? Die Deutschen werfen Bomben über der Festung ab, über Mauds wunderschönen Fußabdrücken, und trotzdem haben alle Läden geöffnet und die Bürger der Stadt spazieren bedächtig umher. Hatte der Mann in der Kongens gate sich geirrt? Nein, Harald hatte die Flieger selbst gesehen, das Dröhnen der Bomben mit eigenen Ohren gehört. Die zertrümmern die Akershus-Festung, zum Henker! Er sieht mehrere junge Männer herumstehen. Warum eilen sie nicht zu ihren Treffpunkten? Er läuft zum Ausstellungsfenster des Morgenbladet, um den Aushang mit den neuesten Nachrichten zu lesen. Die Deutschen marschieren den Drammensveien entlang auf die Stadt zu, steht dort. Er muss den Satz noch einmal lesen, weigert sich zu glauben, dass das wahr sein kann.
In seinem Zimmer am unteren Ende der Pilestredet setzte er sich hin und dachte nach. Er hatte bei seiner Wirtin geklopft, die einen unbeirrten Eindruck machte, aber alles bestätigen konnte. Die Deutschen hatten Norwegen angegriffen. Auch sie hatte es im Radio gehört. Er hatte sie gebeten, das Telefon benutzen zu dürfen, um seine Mutter in Lysaker anzurufen. Mutter wusste immer Rat. Aber es war kein Freizeichen gekommen. Daraufhin hatte er die Wirtin gefragt, ob sie das Radio einschalten könne. Doch ausgerechnet da hatte es keine Sondersendung gegeben, nur Musik, langsame, sinnlose Musik.
Wie wir es vor uns sehen, oder vor uns zu sehen versuchen, könnte er wieder hinausgegangen sein und sich in den Straßen herumgetrieben haben, wobei er vor Aufregung vermutlich vergessen hatte, den Mantel überzuziehen. An einer Ecke der Akersgata standen drei Männer seines Alters, die in den Himmel hinaufzeigten, und Harald hörte sie darüber sprechen, dass ein deutscher Flieger die Flugabwehr auf dem Dach des Redaktionshauses der Tidens Tegn unter Beschuss genommen hatte. »Was tun wir?«, fragte Harald. »Viel können wir wohl nicht tun«, sagte ein kleiner Hagerer. Ob kein Befehl zur allgemeinen Mobilmachung ausgegeben worden sei, wollte Harald wissen. Ob die Regierung denn nicht den Krieg erklärt habe? Aus den Gesichtern der anderen war abzulesen, dass auch sie im Unklaren waren. Harald hopste beinahe vor Ungeduld. Wieso nutzte die Militärführung nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel; warum ertönten keine Sirenen, warum erklangen keine Kirchenglocken, warum waren nicht überall Plakate angeschlagen? »Wisst ihr, wo ihr antreten sollt?«, fragte Harald stattdessen. Die anderen wussten nichts von einem Plan, irgendwo antreten zu müssen, es gab keine eindeutigen Befehle. »Bringt ja doch nix«, sagte einer. »Mein Mobilmachungsstützpunkt ist jedenfalls die Akershus-Festung«, sagte Harald. »Viel Spaß auch«, entgegnete der Hagere. »Hab gerade gehört, dort stehen schon die Deutschen. Beim Parlament auch. Ein einziges Chaos. Wir können einen Dreck tun.« Er bot Harald eine Zigarette an, die er annahm, die aber zu Boden fiel. Er blickte auf seine Hand hinunter und sah, dass er zitterte, vor Wut zitterte.
Sie hatten die Stelle bombardiert, wo Maud noch vor kurzem mit Schnee in den Wimpern gestanden hatte, und keiner dachte daran, auch nur einen Finger zu rühren.
Harald kehrte in sein Zimmer zurück. Er hatte sich – stolz und lautstark – als Kriegsgegner ausgegeben. Schön und gut. Aber jetzt, inmitten der Katastrophe, von der er nie geglaubt hatte, dass sie eintreten würde, von dem Moment an, als er die Bomben niedergehen sah, da ihm zu Bewusstsein kam, dass die Deutschen imstande waren, alles zu morden, was ihm lieb war, wurde er von einer Wut erfüllt, die irgendwie alles veränderte. Nein, nicht von Wut. Von einem blinden Zorn. Im Kopf sah er Bilder von deutschen Soldaten, die in sein schönes Vaterland gestampft kamen. Der Gedanke war unerträglich. Er fühlte sich losgelöst. Er empfand eine Art Glück in dieser umwälzenden Situation, erkannte darin auch eine goldene Gelegenheit, sich selbst zu überraschen. Sein kampfeslustiger Bruder lag bestimmt schon irgendwo draußen bei Lysaker und ballerte Deutsche nieder, die gerade in Fornebu aus ihren Flugzeugen herauswatschelten. Sofern Sigurd sich nicht längst am Gjelleråsen eingefunden hatte und dort in Stellung gegangen war.
Die Deutschen wollten in Norwegen einfallen? Darauf konnten sie warten, bis sie schwarz wurden.
Die ganze nächste Stunde lief Harald auf Hochtouren, er suchte Freizeitkleidung heraus, packte einen Rucksack und befüllte ihn mit Dingen, die man für mehrere Tage und Nächte im Freien benötigte, Essen, Besteck, Toilettenartikel, Handtücher, Schlafsack. Er wickelte einen neuen, dünnen Verband um seine linke Handfläche; der Schnitt war weniger tief, als er angenommen hatte, aber er lächelte, wie über die Vorstellung, dass er bereits verwundet sei. Von einem Schwert! Aus der Abstellkammer holte er noch schnell Skier und Stöcke und begab sich im Laufschritt in Richtung Storgata, fühlte sich stärker denn je, in Hochstimmung, unbesiegbar. Die Sonne schien jetzt, ein Wetter, das mit der Situation kollidierte. An mehreren Stellen sah er Ansammlungen junger Männer an den Straßenecken. »Wir müssen kämpfen!«, rief er. »Das bringt nichts«, lautete die immer wiederkehrende Antwort. »Sie sind überall.« Er kam am Youngstorget vorbei und forderte ein paar Jugendliche auf, sich ihm anzuschließen. »Wir haben die Waffen niedergelegt!«, sagte einer. »Gerade haben wir gehört, dass Oslo sich den Deutschen ergeben hat.« Harald dachte: Ich nicht! Niemals! Ich werde in den Treppenhäusern kämpfen, in den Straßen, den Bergen, ich werde im Wald kämpfen, ich werde niemals aufgeben! Verdammt nochmal, nie! Auf einmal ergab solches Denken einen Sinn. Eigentlich gab es keine Alternative. Er schämte sich der Worte, die er bei Mutters idiotischer Feier heruntergeleiert hatte. Es war alles ganz einfach.
In der Storgata springt er auf einen Pritschenwagen, auf dessen Ladefläche zwei junge Männer mit Rucksack sitzen. Sie geben ihm ein Zeichen, dieselbe Entschlossenheit im Blick wie er selbst, voll zielgerichteter Wut. Er nimmt an, dass sie in nördliche Richtung fahren, den Trondheimsveien hinauf, doch der Wagen biegt in die Brugata ein, auf den Mosseveien zu. Er bittet sie anzuhalten, worauf die beiden erklären, in Askim seien Streitkräfte stationiert, und in einem neuerlichen Gefühl des Losgelöstseins und zugleich voller Elan, sich Leuten anzuschließen, die zu kämpfen bereit sind, denkt Harald: Genauso gut kann ich dort mithelfen, die verdammten Deutschen aufzuhalten. Langsam holpern sie die Stadt hinaus, auf den Straßen herrscht Gedränge. Die ganze Zeit über halten sie Ausschau nach deutschen Truppen, doch an der matschigen Straße entlang sehen sie nichts als verwirrte norwegische Bürger, von denen keiner diese drei Männer mit aufmunternden Zurufen bedenkt, Männer, die bereit sind, in den Kampf zu ziehen gegen die Nazigewalt, die so bösartig eine schlafende Nation überrumpelt hat.
*
Achtundvierzig Stunden später, am Donnerstag, lag Harald Keller an der Brücke bei Fossum in Stellung, dort, wo die aus der Hauptstadt führende Bundesstraße direkt vor Askim den Fluss Glomma kreuzte. Falls die Deutschen im Sinn hätten, die Flanken zu sichern und zugleich die Festungsanlagen auszuschalten – und jede Kriegskunst sprach dafür – würden sie diesen Weg entlangkommen. Zumindest ein paar Bataillone.
Viel war geschehen in den letzten Tagen. Oslo war erobert worden, ohne jeden Widerstand – eine Schande. Wie war das möglich? Harald und die anderen hatten von Quislings Radioansprache Wind bekommen, sie hatten gehört, der König und die Regierung seien auf der Flucht nach Norden, sie hatten von Oscarsborg gehört und dem Kreuzer Blücher. Wo zur Hölle war die britische Marine?, dachte Harald. Waren die nicht, vollbeladen mit Minen, vor der gesamten Küste stationiert? Wie war es den deutschen Schiffen gelungen, sich an der vermeintlich stärksten Kriegsflotte der Welt vorbeizuschummeln? Die Westmächte mussten doch von dem Angriff gewusst haben, ganz sicher war bereits Tage zuvor von Geheimagenten eine erhöhte Schiffs- und Truppenkonzentration gemeldet worden. Es war jedenfalls noch nicht zu spät, dachte Harald. Er sah vor sich, wie Zehntausende andere norwegische Männer rundum in Norwegens weiten Landen sich an ihren Mobilmachungsstützpunkten eingefunden hatten und jetzt, so wie er, in Bereitschaft waren, den Finger am Abzug, darauf vorbereitet, strategisch wichtige Ziele auf Biegen und Brechen zu verteidigen.
Harald und die zwei anderen vom Pritschenwagen waren bis zum Lehrerzimmer der Askimbyen-Schule gelangt, wo sie eingetragen worden waren und ihnen Kleidung, Ausrüstung und ein Krag-Jørgensen-Gewehr samt Munition ausgehändigt wurde. Alle hatten eine kurze Einschulung oder Auffrischung im Waffengebrauch erhalten. Harald wurde der Maschinengewehr-Einheit zugeteilt. Bei der ganzen sinnlosen Exerziererei am Truppenübungsplatz hatte es ihm immer vor der Vorstellung gegraut, Teil einer Masse zu sein, die marschierend ihr Land verteidigte. Und hier war er nun, zwar nicht marschierend, aber doch volle Fahrt voraus in den Krieg, mit jeder Faser seines Körpers zum Kämpfen bereit.
In der Schule hatten sie Verpflegung bekommen und auch geschlafen, und schon bei Tagesanbruch am Mittwoch waren sie, die dritte Brückengruppe, dreißig Mann und vier Vorgesetzte, in zwei Bussen zur Brücke bei Fossum gefahren worden. Es war bewölkt, kein Niederschlag, kalt. Harald, einer der wenigen, der über Erfahrung am schweren Maschinengewehr Browning M/29 verfügte, wurde als Schütze in einer der drei Maschinengewehr-Einheiten eingesetzt; sie waren zu viert in jeder Gruppe, hätten mehr sein sollen, aber vier waren genug. Die meiste Zeit des Tages verging mit Verschanzen. Sie standen knietief im Schnee, in Schluchten und Gräben sanken sie bis zu den Hüften ein. Schussfelder wurden ausgehoben. Auf dem Hang bei Askim, fast auf gleicher Höhe mit der Brücke, fand Haralds Gruppe eine kleine Mulde, die gute Deckung bot. An diesem Tag fanden sie sogar ein bisschen Schlaf, ein paar Stunden auf einer Strohmatratze in dem Haus unten am Fluss, in dem der Kapitän seinen Kommandoplatz hatte, sogar zu essen bekamen sie, aus einer Feldküche, sein eigenes Lunchpaket war längst aufgebraucht, aufgeteilt auf die anderen, und Harald ertappte sich dabei, dass es ihm Bewunderung abrang, wie durchgeplant alles war, wie reibungslos alles zu funktionieren schien, er war von Optimismus erfüllt, von dem Glauben, der bloße Anblick dieses Willens zum Widerstand überall in Norwegen, dieser gutgeölten Maschinerie, würde die Deutschen so entmutigen, dass sie sich höflich verneigten, auf dem Absatz kehrtmachten und die ganze Invasion abbliesen.
Am Donnerstag stand wieder Drill am Programm, Gewehrreinigung, Grundlagentraining – die ohne militärische Ausbildung wussten noch nicht einmal, wie man Patronen in eine Krag-Jørgensen einlegte oder wie das Nachladen funktionierte. Haralds Team trainierte am Maschinengewehr, Schlagbolzenwechsel und Kühlwassertausch, um ein Überhitzen der Waffe zu verhindern. Sie befanden sich in fortwährender Anspannung. Kamen die Deutschen? Weil der Fähnrich nun doch der Meinung war, die Stellung von Haralds Team liege zu weit unten, mussten sie das Browning M/29 wieder auseinanderbauen, Waffe, Rohrwiege und Lafette, Munitionskästen und die gesamte Ausrüstung höher den Hang hinauf verlegen. Sie hatten schwer zu tragen, der Schnee war brüchig und sie sanken ständig bis zu den Knien ein, endlich aber hatten sie das Maschinengewehr an neuer Stelle montiert, ein neues Schussfeld freigeräumt und zur Tarnung Nadelbaumzweige herangeschafft.
Unter ihnen lag die Glomma, deren festes Eis von einem Ufer zum anderen reichte, sowohl ober- als auch unterhalb der Brücke. Bei Ankunft der Deutschen sollte die Brücke gesprengt werden. In der Sprengkammer wartete die Ladung bereits auf ihren Einsatz. Harald saß fröstelnd in Stellung. Diese Konstruktion eines Brückenpfeilers mit Sprengkammern brachte ihn ins Stutzen. Beim Bau einer Brücke gleichzeitig die Möglichkeit ihrer Zerstörung mit einbauen! Als ob die Zivilisation jederzeit die Barbarei miteinrechnen müsse.
Die Dämmerung brach herein. Er betrachtete die Farben im Schnee, der hier wesentlich höher lag als in der Stadt. Auf einmal musste er an seinen Grundschullehrer denken, der ihnen gezeigt hatte, wie man beim Malen einer Winterlandschaft den Schnee mit blauen Schatten versehen konnte, wie schön, wie naturgetreu es dann wirkte. In Askim hatte er die Skier ablegen müssen, konnte sie nicht gebrauchen. Idiotisch. Er bereute es, dass er nicht lieber rauf nach Maridalen gegangen und dort in den Wald hinein verduftet war. Er hätte die Nordmarka durchstreifen können, diese Gegend, die er so gut kannte. Kilometerweit dichter Wald, in dem man sich verstecken konnte. Die jungen Männer mussten sich jetzt zu Dutzenden dort eingefunden haben, in jeder Hütte, jeder Waldbaracke, unter jeder Hügelkuppe. Ein perfekter Ort als Basis für den Widerstand. Harald fantasierte davon, wie er im weißen Tarnanzug mit einem Gewehr am Oppkuven lag und fast eigenhändig die halbe Nordmarka von Deutschen freihielt.
Dann war sie wieder da. Maud. Mauds Wimpern. Mauds Hütte tief im Waldinneren. Bald drei Wochen war es her, dass er dort vor dem Kamin gesessen war und Shakespeare zitiert hatte, und dann … Der bloße Gedanke daran schmerzte. Er hatte es niemandem erzählt, auch Sigurd nicht, hatte nicht einmal erwähnt, dass er dort gewesen war, dass er Samstag dann doch noch zur Hütte aufgebrochen war. Du liebe Güte, wie er es bereute. Er hätte alles darum gegeben, diesen Tag noch einmal erleben zu dürfen. Auch bei Mutters alberner Geburtstagsfeier hatte er keine Gelegenheit gefunden, sich mit Maud unter vier Augen zu unterhalten. Eigentlich hatte es ihn überrascht, dass sie überhaupt dagewesen war. Oder war sie nur deshalb gekommen, weil sie seine Mutter bewunderte? Maud redete oft von »Rita Bohre«, als ob sie ein Symbol wäre; sie sprach, und das mit erstaunlichem Enthusiasmus, über alles, was seine Mutter erreicht hatte, was das für jüngere Frauen bedeutete. Im Stillen hatte er sich darüber geärgert, weil er befürchtete, im Schatten seiner Mutter zu stehen. Schon am Tag nach der Feier hatte er sich geschworen, Maud zu fragen, ob sie mit ihm ausgehen wolle, hatte sich ausgemalt, wie er sie in das im obersten Stock des neuen, tempelähnlichen Folketeater-Gebäudes gelegene Restaurant Skansen ausführte, wie er ein paar Worte über die Aussicht verlor und sie gleichzeitig um Vergebung bat. Vielleicht konnten sie hinterher tanzen. Und danach dann … Es hätte ein Abend werden sollen, an dem sich alles entschied, an dem alle Karten auf den Tisch gelegt wurden. Und wenn er schlicht und einfach um ihre Hand anhielte?
Stattdessen sitzt er nun hier, dem Mond näher als dem Tanzparkett des Stratos, näher an Sirius als an Mutters Villa voll mit Gemälden und Bachs Musik und Teppichen aus Isfahan und dem ganzen unverbindlichen Gefasel, das man nach einem erlesenem Mahl und jeder Menge guten Weins vor dem Kamin von sich gab. Hinter einer Waffe mit eingelegtem Gurt für 250 Schuss sitzt er im Schnee, bereit, jeden uniformierten Deutschen zu töten, der auch nur seine Nasenspitze auf der anderen Seite des Flusses herausstreckt. Er ertappt sich dabei, wie ihm der Mund offen steht vor dieser Spannbreite, dieser Fülle an Möglichkeiten, die in einem Menschen verborgen lagen.
Maud. War sie, neben all dem anderen, der Grund dafür, dass er jetzt hier war? Seine Schuldgefühle?
Er fror, sogar mit seiner eigenen Mütze unter der Feldhaube und einem Pulli unter der Lodenjacke. Auch einen Schal hätte er noch vertragen können. Er saß in der Stellung zusammen mit Geir, dem Gruppenkommandantstellvertreter, der für das richtige Einsetzen des Patronengurts zuständig war. Geir hatte noch nicht einmal die Rekrutenausbildung absolviert, hatte aber an der freiwilligen militärischen Schulung teilgenommen, die direkt nach Weihnachten abgehalten worden war. Er stammte aus Råde, und im Gegensatz zu den anderen ruchlosen Feiglingen, denen er in Oslo begegnet war, hatte er sich hierher begeben, als ob es das Selbstverständlichste auf der Welt wäre. Beide waren sie wieder hungrig. War der Nachschubweg aus Askim zusammengebrochen? Harald fantasierte von dem Essen seiner Mutter, dem Essen seiner Kindheit. Sie war vielleicht keine große Köchin, aber so lange er lebte, wäre ihm ihr Essen das liebste, Lammsteaks und Koteletts, Würstchen und Frikadellen, gekochter Dorsch, gebratene Makrelen. Erbsensuppe. Beim bloßen Gedanken an Mutters Erbsensuppe mit Fleisch grub sich ihm ein Loch in den Bauch.
Der Abend wurde lang. Noch länger die Nacht. Wo blieben denn nun die verhassten Deutschen, die sein zerfurchtes, wettergepeitschtes, geliebtes Land zu besudeln gedachten? Er fror, versuchte es mit Bewegung. Inzwischen musste es Minusgrade haben. Er nickte ein, bekam aber nichtsdestoweniger mit, dass um Mitternacht herum Verstärkung eintraf, mehrere Vorgesetzte, noch mehr Maschinengewehre, die Befehle wanderten von Mund zu Mund, sie mussten inzwischen über hundert Mann sein, aber noch immer fehlten ihnen wichtige Waffen – Maschinenpistolen, Handgranaten, Minenwerfer. Unten im Haus des Hauptmanns legte Harald sich für eine Stunde auf der Strohmatratze aufs Ohr, bevor er wieder in die Stellung hinaufkletterte. Endlich wurde ein wenig Verpflegung herbeitransportiert, Lapskaus diesmal. Himmlisch. Etwas, das auch seine Mutter gekocht hatte. Und das sie auch hin und wieder in der Kikutstua gegessen hatten. In Gedanken schickte Harald einen Dank an die Mädchen in Askim, die diese Mahlzeit zubereitet hatten. Die ganze restliche Nacht verbrachte er fast unablässig damit, auf die andere Seite hinüberzuspähen. Kurz sah er den Himmel aufblitzen, einen Halbmond, schob den Gedanken an eine Sichel, den Tod, aber beiseite. Mehrmals nickte er ein und fiel mit der Nase auf das Maschinengewehr, Waffengeruch stahl sich in einen undeutlichen Traum.
Frühmorgens erwachte er mit einem Schlag. Busse, vollbeladen mit Deutschen, waren auf dem Weg. Er stand auf, schlug die Arme übereinander, um sich warm zu halten. Der Fernsprecher unten beim Hauptmann bekam noch eine letzte Meldung, als die Deutschen die Beobachtungsposten in Spydeberg passierten. Wenn die Busse oben rechts auf der anderen Flussseite aus der Kurve herauskamen, mussten sie vor Erreichen der Brücke hundert Meter neben einer steil abfallenden Felswand entlangfahren, die ganze Strecke seitlich zu den Stellungen, die 150 bis 200 Meter entfernt versteckt auf der Askimer Seite lagen. Wie Zielschießen, dachte Harald.
Er ließ sich auf den Sitz hinter dem Maschinengewehr fallen und legte die Hände an den Griff. Unmöglich, das Herzklopfen loszuwerden. Doch der Anblick der schmalen Straße, die auf der anderen Seite an der Klippenwand entlang freigesprengt worden war, machte ihm Mut. Oslo, diese Scheißstadt mit ihren handlungsunfähigen Krämern, mochte verloren sein. Das Gold Norwegens war die Natur. Die wilde, unwegsame Natur. Die vielen Berge, Fjorde, Wälder. Es stimmte, was Onkel Albert auf Mutters Party gesagt hatte: Norwegen war eine riesige, uneinnehmbare Festung. Man schaffte es kaum, Eisenbahnen in diesem Land zu bauen. Sowohl der Vater als auch der Großvater hatten abends an Haralds und Sigurds Bettkante gesessen und ihnen von den Herausforderungen beim Bau der Bergensbane erzählt, von Tunneln durch Berge, Brücken über schwindelerregende Schluchten, von Schneestürmen, die über die Ebene fegten. Jede fremde Macht, die dieses Land zu okkupieren versuchte, würde sehr bald erfahren, wie unmöglich es war, sich über einen längeren Zeitraum hier festzukrallen.
Die Sinne aufs Äußerste angespannt, fühlte er sich plötzlich mit einer Hypersensibilität ausgestattet, wie ein Tier. Es erinnerte ihn an das Versteckspiel seiner Kindheit und an die Zeit seines sexuellen Erwachens, als er die Mädchen riechen, durch ihre Kleidung hindurchsehen, ihr Atmen hören konnte; als ein Kuss wie ein langes Gespräch schmeckte und eine Hautberührung ihm elektrische Stöße versetzte.
Maud.
Alles war still. Eine gespenstische Stille. Einige Singvögel saßen unterhalb im Gebüsch, aber ihr Gesang war nicht zu hören. Nicht einmal das Geräusch des ersten Busses hörte er, sah nur etwas Gelbes überdeutlich im Schneematsch auf der Straße zum Vorschein kommen und so um die Kurve biegen, dass dessen gesamte Längsseite sichtbar wurde. Ein Schøyen-Bus. Einer dieser Busse, die er früher täglich gesehen hatte, die jetzt aber voll waren mit Deutschen. Mit Feinden. Er zielte, hatte die gelbe Metallfläche vor dem Korn und das Korn stabil in der Kimme. Der Bus verlangsamte die Fahrt. Der Fahrer musste die Rundhölzer entdeckt haben, die direkt vor der Brücke den Weg versperrten. Mehrere Deutsche sprangen heraus. Harald und die anderen hatten Befehl, so lange mit dem Schießen zu warten, bis sich so viele Busse wie möglich auf der Strecke zwischen Kurve und Brücke befanden. Dann knatterte es. Die Stellung rechts von ihnen, die den Deutschen am nächsten lag, hatte nicht länger zuwarten können. Der zweite Bus kam in der Kurve in Sicht, hielt aber an. Und jetzt ging der Krach erst richtig los. Harald konnte leere Patronenhülsen unter der Waffe in den Schnee rattern hören. Er wartete, dass die deutschen Soldaten aus den Bussen herausströmten und das Feuer erwiderten, aber es kam niemand zum Vorschein. Ein strenger Befehl ließ sie schließlich das Feuer einstellen. Erst jetzt nahm er den strengen Geruch nach Pulvergas wahr. Oder nach Tod. Nach einer Wirklichkeit, die jenseits von dieser lag. Er spürte einen Druck in den Ohren und ein Zittern in den Gliedern, als wäre ihm ein Aufputschmittel in die Venen gepumpt worden. Von der anderen Seite her war Motorendröhnen zu hören, der zweite Bus setzte zurück und verschwand aus ihrem Sichtfeld. Jetzt wussten die Deutschen dahinter Bescheid, sie würden die Taktik ändern. Trotzdem jubilierte er innerlich. Was für ein Triumph. Hier lagen sie, einige wenige Männer, und konnten es mit einem ganzen Heer aufnehmen. Er blickte zu dem durchlöcherten Bus auf der anderen Seite, dessen Scheiben geborsten waren. Alle Soldaten, sowohl die draußen als auch die drinnen, mussten tot sein. Er fühlte nichts. Völlig ruhig dachte er: So müssen wir kämpfen. So müssen wir den hochnäsigen Eindringling niederringen.
Immerhin war er nicht so taub, als dass er den Befehl des Hauptmanns zur Sprengung der Brücke nicht mitbekommen hätte. Ein perfekter Plan. Harald wartete auf den gewaltigen, befreienden Knall, doch nichts geschah. Zwischen den beiden obersten Hölzern der Deckung guckte er zur Brücke hinunter. Ein Soldat machte verzweifelte Gesten in Richtung des Hauptmanns. Das elektrische Zündsystem musste versagt haben. Danach gingen rasch Befehle zwischen den Stellungen hin und her, und während sie das Gebiet bestrichen, in dem die Deutschen lagen oder noch auftauchen konnten, lief einer der Feldwebel – wie verdammt heldenhaft!, hatte Harald noch Zeit zu denken – zur Brückenmitte und sprang in den Schacht hinunter, wo es ihm gelang, die Reservelunte von Hand zu zünden, und nicht weniger wichtig: wieder herauszuklettern und zurückzukehren, bevor die Ladung detonierte. Der Boden zitterte von der Explosion, und Harald vernahm Geirs Jubelrufe, irgendwie mehr aus Stolz als vor Freude. Vor seinem geistigen Auge sah Harald die vielen Brücken, die dieser Tage in Norwegen zerstört würden. Die Deutschen würden nirgendwohin kommen. Sprengt die Tunnel und Brücken, und der Feind ist chancenlos! Er war kurz davor, einen Hurraruf auszustoßen, verbiss es sich aber, denn durch das Guckloch sah er, wie die Brücke angehoben wurde, die Betondecke die Form eines Propellers annahm und wieder auf den starken mittleren Brückenpfeiler zurückfiel. Die Fahrbahn war schief und wellenförmig, aber leider weiterhin passierbar – an dieser Stelle fügt es sich übrigens gut, unserer N20-Assistenengruppe ein Lob auszusprechen, denn obwohl einst viertausend Bücher über den Krieg in Norwegen erschienen sein sollen – offenbar war die norwegische Bevölkerung unersättlich nach neuen Versionen dieser Erzählung –, und uns heute lediglich Fragmente zur Verfügung stehen, ist es der Gruppe dennoch gelungen, in diesen Büchern sowie einer Reihe anderer obskurer Quellen Details aufzuspüren, die, so weit wir das beurteilen können, eine zuverlässige Rekonstruktion der hier geschilderten Kampfhandlungen ermöglicht.
Jetzt hieß es abwarten. Ohnehin konnte Harald nicht mehr tun, als Kühlwasser nachzufüllen und die Waffe zu kontrollieren, bevor das Chaos ausbrach; Deutsche tauchten in dem bewaldeten Kurvenabschnitt auf, einige nahmen die norwegischen Stellungen unter Beschuss, andere versuchten, den zugefrorenen Fluss zu überqueren. Während Geir den Munitionsgurt hielt, feuerte Harald kurze Salven ab, konzentrierte sich auf die Soldaten, die bis ans andere Ufer gelangt waren. Gleichzeitig musste die Aufforderung erfolgt sein, den Staudamm von Solberg zu öffnen, denn durch das herabflutende Wasser wurde das Eis aufgebrochen. Jene wagemutigen Deutschen, die über die Eisschollen zu springen versuchten, wurden von den am nächsten zum Ufer positionierten Norwegern niedergeschossen. Bald war der ganze Angriff abgewehrt.
Stille. Verdächtige Stille.
Nicht aber im Kopf.
Es musste der malträtierte Bus gewesen sein, der seine Gedanken auf etwas umleitete, das er am ersten Tag in Askim gesehen hatte. Eine Lokomotive war aus Mysen herangeschafft worden und stand jetzt am ersten Gleis in der Bahnstation Askim, damit sie, falls die Deutschen mit der Eisenbahn, mit dem Transportzug aus Oslo kämen, dagegengefahren werden konnte. Das brachte seine Gedanken auf Otto Keller, seinen Vater.
Harald war seinem Vater sehr nahegestanden, weshalb es ihn umso schwerer getroffen hatte, als seine Eltern die Unerhörtheit begingen, sich scheiden zu lassen, eine Seltenheit damals. Im Gegensatz zu Sigurd und Bjørg hatte er den Nachnamen seines Vaters behalten, und im Gegensatz zu seinem Bruder hatte er ihn sowohl in der Halvdan Svartes gate als auch in seinem Büro besucht – auch deshalb vielleicht, weil er ihn als ein Rätsel betrachtete. Mindestens einmal die Woche war Harald bei seinem Vater gewesen, doch wenn er nach Hause gegangen war, hatte er stets gedacht: Ich kenne ihn nicht.
Otto Keller war als Ingenieur in den Thune-Werkstätten in Skøyen angestellt, in den riesigen, zwischen Drammensveien und der Eisenbahnstrecke gelegenen Hallen. Besonders in seiner Kindheit hatte Harald es spannend gefunden, mit seinem Vater dort umherzustreifen und den Arbeitern zuzusehen, die gerade mit der Herstellung von Teilen beschäftigt waren, aus denen später Turbinen oder Lokomotiven entstehen sollten. Am allerliebsten jedoch saß Harald mit einem Blatt Papier im Büro und zeichnete, während sein Vater etwas weiter weg vor riesigen gezeichneten Plänen saß, die Harald nie in Zusammenhang zu bringen vermochte mit dem, was in den Hallen vor sich ging. Anfang der 30er-Jahre hatte sein Vater mit der Arbeit an der Konstruktion eines Lokomotiventyps begonnen, der größer und stärker sein sollte als alles bis dahin in Norwegen Gesehene. Harald durfte sich die puzzleähnlichen Zeichnungen ansehen, die er zwar schön fand, bei denen er sich aber nie vorstellen konnte, wie das, was auf ihnen dargestellt war, in Wirklichkeit aussehen würde.
Eines Abends, nachdem sie in der Halvdan Svartes gate gemeinsam gegessen hatten, nahm sein Vater ihn mit runter zum Ostbahnhof. Harald war 14 Jahre alt. »Ich möchte dir etwas zeigen«, sagte sein Vater. Das war typisch für ihn, er sagte nie viel. Als Harald noch kleiner war, hatten sie oft zusammen Dinge im Garten oder an Bächen gebaut, Wasserräder oder kleine Brücken aus Kleinholz und Bindfäden, und nur zwischendurch hatte sein Vater etwas gesagt oder erklärt. Die Scheidung seiner Eltern war für Harald ein Rätsel. Eines Tages war seine Mutter mit den Kindern einfach nach Lysaker gezogen, und sein Vater war allein in der Halvdan Svartes gate zurückgeblieben. Wenn Harald später eine Andeutung in diese Richtung gemacht hatte, war der Vater nur noch schweigsamer geworden. An diesem Abend allerdings war er ungewohnt aufgeregt, ging leichten Schritts durch den Haupteingang des stattlichen Bahnhofsgebäudes, bei dessen Ausbau Haralds Großvater ganz zu Anfang seiner Karriere, als Angestellter in Georg Andreas Bulls Architekturbüro, mitgewirkt hatte.
Vor einem der ganz hinten gelegenen Bahnsteige stellte der Vater sich auf. »Was machen wir hier?«, fragte Harald. »Wart nur ab«, sagte der Vater und deutete hinauf zu den schönen, gusseisernen Gewölben, als wolle er etwas über die Ingenieurskunst äußern. Eine Viertelstunde vielleicht standen sie dort, blickten zu den rußigen Glasdächern hinauf, beobachteten die Tauben und die wenigen Fahrgäste auf den anderen Bahnsteigen. Dann warf der Vater einen Blick auf die Uhr und lächelte Harald zu. »Jetzt«, sagte er und nickte in Richtung des Stadtteils Gamlebyen. Zuerst konnte Harald in dem Halbdunkel nichts als Rauch erkennen. Allmählich aber stieg aus dem Dampf die Front einer Lokomotive empor, ein riesiges Biest. Die Schienen begannen zu singen, oder zumindest klang es für Harald wie ein Singen, eine dunkle Melodie. In seiner Fantasie sah er ein tobendes Elefantenmännchen auf sich zulaufen, doch bald darauf bäumte sich die Lokomotive zu etwas noch Größerem, noch Gewaltigerem auf, einer schwarzen Wand prustender Rohkraft, und noch gewaltiger wurde es, als sie schließlich abbremste und Harald das Fuhrwerk auch von der Seite sah, begleitet von einem ohrenbetäubenden Quietschen und dem Geräusch der Stempel, während der Lokführer gleichzeitig noch an der Pfeife zog. Vater zu Ehren, dachte Harald.
»Die Dovregubben«, sagte der Vater, als spräche er wahrhaftig von einem Troll. »Die erste von vielen, die wir ausliefern werden«, sagte er. »150 Tonnen, sofern wir das Gewicht des Tenders dazurechnen.«
Natürlich hatte Harald davon gehört, jedoch war es unmöglich für ihn, einen Zusammenhang herzustellen zwischen dem, was er auf dem Schreibtisch seines Vaters gesehen hatte, diesem ganzen Gerede über »Treibraddurchmesser« und ein »zweiachsiges Drehgestell mit Helmholtz-Lenkgestell«, und dem schwarzen, mächtigen Monster, diesem, ja, diesem kriechenden Troll, der da vor ihm auf den Gleisen stand und förmlich in den Stahlmuskeln bebte. 22 Meter lang, mit Rauchschirmen wie zitternde Elefantenohren. Sein Vater und der Heizer beschauten sich das Triebwerk. Wieder: Vaters Euphorie. Danach durfte Harald mit in den Führerstand hochkommen, wo der Vater zu erklären, zu deuten und zu lachen anfing und währenddessen seinem Sohn liebevoll die Schulter drückte, ein Moment, an den Harald sich immer als einen Wendepunkt erinnern sollte, denn als er im Führerstand dieser gigantischen Maschine stand, war es ihm nicht nur, als ob diese großen, ungeheuer komplizierten Zeichnungen, die er in den Thune-Werkstätten gesehen hatte, zu etwas Dreidimensionalem, zu etwas Sinnlichem wurden, sondern als ob auch sein Vater, dieses unverständliche Wesen, immer greifbarer und handfester vor ihm zutage träte, zu einem Menschen wurde, der sein Leben etwas Schöpferischem widmen, der die Menschheit voranbringen wollte.
Verhielt es sich so vielleicht auch mit dem Krieg?, dachte Harald fröstelnd zwischen den Bäumen bei der Fossum-Brücke. Nur mit umgekehrten Vorzeichen? Der Unterschied, ob man bloß darüber las, Sigurds Erzählungen über verschiedene Schlachten hörte, oder ob man selbst die Sturzbomber sah, sie heulend auf Akershus herabfallen hörte, die Explosionen, den Erdboden zittern spürte oder hier auf dem Sitz hinter einem Maschinengewehr saß, das heiße Metall und das Öl roch, darauf wartend, dass noch einige mehr kämen, denen man das Licht ausknipsen konnte. Und besonders dann, wenn diese »Einigen« Teil von einem selbst waren. Sein Vater, Otto Keller, war zur Hälfte Deutscher. Sigurd hatte versucht, diese Tatsache, so gut es ging, unter den Tisch zu kehren, und Harald schon früh dazu angehalten, so wenig wie möglich darüber zu sprechen. Nur Onkel Albert streute hin und wieder ein paar giftige Andeutungen ein. Ottos Vater, Haralds Großvater, war einer von mehreren gut ausgebildeten Deutschen, die sich vor der Jahrhundertwende in Norwegen niedergelassen hatten. Vor zwei Jahren war ihr Vater dann für Ausbesserungsarbeiten an der Dovregubben-Lokomotive nach Essen gezogen. Stolz hatte er erzählt, dass auch die Hauptgeschütze, die in Oscarsborg zum Einsatz kamen, von der in Essen ansässigen Firma geliefert worden seien. Was für eine Ironie, dachte Harald jetzt. In seinem letzten Brief hatte der Vater geschrieben, er habe eine neue Arbeit gefunden und wohne jetzt in Hamburg, der Heimatstadt seines Vaters, wo er als Kind häufig zu Besuch gewesen sei. »Hier bin ich sicher«, hatte er geschrieben, als ob er gewusst hätte, befürchtet hätte, dass da etwas im Anzug war, oder als sei ihm bewusst gewesen, dass die Tatsache, Deutscher zu sein, und sei es auch nur zur Hälfte, sich in Norwegen bald als problematisch erweisen könnte.
Die Dovregubben. Ein Wunder an menschlichem Erfindergeist. Später allerdings konnte Harald sich nie ganz von dem Gefühl lossagen, dass sie eher unheimlich als beeindruckend wirkte, und nicht selten tauchte die schwarze, dampfende Konstruktion, mit dem einzelnen Scheinwerfer als Zyklopenauge, in seinen Alpträumen auf.
Es ist, als wäre seine Wut durch die Gedanken an seinen Vater abgeschwächt worden. Hatte er jemanden getötet? Waren durch seine Kugeln Soldaten im Bus getroffen worden? Verstört starrt Harald zum Fluss hinunter, während weitere Minuten dahinticken. Plötzlich sieht er seinen Geografielehrer vor sich, erinnert sich an alles, was er ihnen über den Fluss Glomma beigebracht hat, wo er entspringt, an welchen Orten er vorbeifließt. Vierte Klasse. Eine beachtliche Leistung: Einer Horde ignoranter Jungen Wissen eintrichtern. Doch was nützte ihm das jetzt? Er trank aus der Feldflasche, versuchte etwas Brot hinunterzubekommen, einen Kanten, den er in der Tasche stecken hatte, aber er war nicht hungrig. Dann knatterte es von der Spitze der Felswand auf der anderen Seite. Weitere Salven folgten, und um sie herum peitschten Projektile in den Schnee. Das Gewehrkrachen war von einer solchen Trockenheit, dass es völlig ungefährlich wirkte. Unmöglich die Vorstellung, dass das den Tod bedeuten konnte. Alle norwegischen Stellungen erwiderten das Feuer. Harald konnte nicht erkennen, ob er traf, er schoss einfach. »Es müssen Hunderte sein!«, hörte er einen Vorgesetzten rufen.
In einer Unterbrechung des Schusswechsels gelang es Harald, sich für einen Moment über die Situation zu erheben, über das Absurde daran nachzudenken, Menschen zweier Nationen, die die Luft zwischen sich mit todbringendem Blei füllten. Es war ein schöner Tag, Sonnenschein, Osterstimmung und schmelzender Schnee, und hier lagen sie und setzten alles daran, sich gegenseitig umzubringen. Ich hätte auf einer Skitour mit Maud sein sollen, dachte er. Wir hätten Kakao trinken können. Vielleicht hätten wir uns sogar geküsst.
Wie zur Verstärkung des Erlebten, tönte plötzlich leiser Gesang aus der Maschinengewehrstellung herüber. Es war Alf, der Gruppenkommandant, ein junger Unteroffizier. Harald erkannte das Lied. »Der Sonnenschein, der macht mich froh«, eine Melodie, die in den Wochen davor viele vor sich hin gesummt hatten. Harald hatte Lust einzustimmen, hielt sich aber zurück. Das hätte alles nur noch sinnloser gemacht.
Und trotzdem. Die Verteidigung einer Brücke. Einer schmalen Passage. Ein Kriegs-Urdrama. Sigurd war Experte in solchen Dingen, hatte in Kindertagen abends im Bett lebhaft von den Birkebeinern und der Schlacht bei der Hørte-Brücke erzählt, von den Schweden und Russen in der Schlacht bei der Virta-Brücke 1808 und von dem britischen Soldaten Sidney Godley, der ganz allein, mit einem Maschinengewehr, und das in nur zwei Stunden – Harald, stell dir das vor – in zwei Stunden, allein, nach der Schlacht bei Mons 1914 die Deutschen am Überqueren einer Eisenbahnbrücke gehindert hatte und dadurch den Briten und Franzosen Zeit zum Rückzug verschafft hatte. In diesem Moment aber, vor der halb zerstörten Brücke, dachte Harald eher an Leonidas und seine kleine Schar im Kampf gegen das Perserheer, er erinnerte sich, wie ihre Mutter, als sie noch klein waren, in dem großen Ohrensessel vor dem Kamin gesessen und sie mit dieser Geschichte unterhalten hatte; besonders Sigurd konnte nie genug davon bekommen, von Leonidas und den Spartanern zu hören. Allerdings verteidigten sie hier durchaus keine wichtige Straße zu einem Zentrum, das wusste Harald, als er da in der Vertiefung lag, hinter der Deckung, ergo traf das Bild von Leonidas nicht zu, und wenn, dann wohl eher auf die Festungsinsel Oscarsborg und den wachsamen Kommandanten, der vor einigen Tagen diese Rolle übernommen hatte.
Es war ruhiger geworden auf der Anhöhe am anderen Flussufer. Geir hatte eine nicht angezündete Kippe im Mundwinkel und säuberte sich die Nägel mit dem Bajonett. Harald starrte zu den schönen Kiefern dort oben, solchen, die er einst als Silhouetten zu zeichnen gelernt hatte, mit schwarzem Buntstift. Erneut verweilte er in Gedanken bei seiner Mutter und ihrer Leidenschaft für Geschichte. Ihr gefiel nicht, dass Harald Romane las, sie war der Meinung, das, was in diesen Büchern dargestellt wurde, erwecke den Anschein von Tiefgründigkeit, lasse dabei aber alles Unverständliche und Komplizierte außen vor. Vor allem würden sie jener Heerschar an Zufällen keinen Platz einräumen, die nicht nur im Leben jedes Einzelnen eine bedeutende Rolle spielten, sondern ebenso sehr in der Weltgeschichte, die ja nichts anderes sei als die Summe von Menschenleben. »Nehmen wir etwa nur Xerxes’ Feldzug gegen die Griechen«, sagte sie. »Wären die Perser nur mit einer kleinen Streitmacht über die Ägäis gesegelt und im Süden auf der Insel Kythira an Land gegangen, hätten sie die Spartaner in Schach halten können; dadurch hätte der Angriff von Norden einen ganz anderen Ausgang genommen. Dieser Gedanke musste ihnen gekommen sein, aber er wurde nicht in die Tat umgesetzt.« Unlängst, zur Weihnachtszeit, war sie zusammengesunken in dem tiefen Lehnstuhl gesessen und hatte das Unheil verflucht, das über Europa hereingebrochen war. »Hitler soll sich als junger Mann an der Akademie der Bildenden Künste in Wien beworben haben«, sagte sie, »aber er wurde abgelehnt. Was wäre gewesen, wenn er aufgenommen worden wäre? Wäre die jetzige Lage dann eine andere?«
»Anstatt über die Bedeutung von Zufällen zu philosophieren, hätten wir vielleicht besser noch im selben Augenblick, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, einen Widerstand mobilisieren sollen«, sagte Harald.
»Ja, du hast recht«, sagte die Mutter. »Aber wir wissen nicht, ob Hitler nicht schon morgen bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommt, und wer weiß, was dann mit Deutschland passieren wird.«
»Ich glaube nicht, dass du damit rechnen kannst, dass der Zufall sich immer auf deine Seite schlägt«, sagte Harald.
Gegen vier Uhr starteten die Deutschen einen heftigen Angriff. Sie feuerten mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Waffen, auch mit Granatwerfen. In den ersten Minuten hatte Harald mehr als genug damit zu tun, sich hinter der Deckung in das Fichtenreisig zu drücken. Über ihnen pfiffen die Kugeln dahin mit einem unablässigen Piff-Piff, das ihn an das Geräusch erinnerte, das sie als Kinder beim Spiel gemacht hatten, mit dem Unterschied, dass jetzt von den Baumstämmen um sie herum Splitter wegstoben und aus dem Boden kleine Schneesäulen emporragten. Nicht weniger lebensgefährlich waren die von den Felsen zurückprallenden Querschläger. Trotzdem dachte Harald nicht eine Sekunde daran, dass er getroffen werden könnte. Noch weniger, dass er getötet werden könnte. Es gab noch so viel, was er tun wollte. Vor allen Dingen musste er diese Sache mit Maud in Ordnung bringen. Ausgerechnet ihre Stimme war es, an die er jetzt dachte. Vielleicht war es ihre Stimme, in die er sich als Erstes verliebt hatte, als sie am Kikut vor ihm im Schnee lag, peinlich berührt, weil sie so ungeschickt hingeplumpst war.
Dann passiert es. In der Stellung neben ihm richtet Alf sich ein wenig auf, um nachzusehen, ob sich durch eine leichte Lageveränderung des Maschinengewehrs ein besseres Schussfeld einrichten ließe, und im selben Moment trifft eine Salve ihn mitten ins Gesicht. Harald begreift zunächst nicht, was vor sich geht, Alf, der vornüberkippt und über den Kühlmantel fällt, dann herabrutscht und seitlich liegen bleibt, so dass Harald sein malträtiertes Gesicht sehen kann. Alf mit der schönen Singstimme. Ohne weiter darüber nachzudenken, robbt Harald zu ihm hinüber, ruft nach einem Sanitäter, obwohl er weiß, dass sie keine dabeihaben. Doch Alf ist tot. Wie seltsam nass seine Haare sind, wundert sich Harald, ehe er begreift, dass das vom Blut kommt. Er sieht die Bartstoppeln auf Alfs Wange, aber vor allem sieht er seine schönen Wimpern, wie von einem Kind.
Diese Zufälle. Wieso hatte die Kugel Alf getroffen und nicht ihn? Harald hatte ebenfalls überlegt, sein MG dort zu platzieren.
Alle eitlen Bedenken verbannt, kalt, ruhig, zugleich halb bewusstlos vor Raserei, hat er sich in Windeseile wieder auf den Sitz des Maschinengewehrs begeben; die Deutschen beginnen, übermütig zu werden, zeigen sich jetzt vermehrt in voller Größe oben auf dem Bergrücken; er feuert eine Salve ab, worauf einer wie ein geschlachtetes Tier zu Boden geht. Harald genießt den Anblick, ein Genuss, wie er ihn nie zuvor empfunden hat, und in den nächsten Sekunden erschießt er noch mehr Deutsche, von denen einer den Abhang hinunterpoltert, schlaff wie eine Stoffpuppe, Schnee löst sich, ein berauschender Anblick, noch ein Treffer, noch eine Gestalt sackt zusammen, als hätte man die Luft aus ihr entweichen lassen, fällt herunter, schnellt durch die Luft, als sie auf halbem Weg auf einem Felsen auftrifft, Haralds Hände zittern auf dem Doppelgriff, während das Maschinengewehr weiter Kugeln ausspuckt, das Triumphgefühl, das er dabei empfindet, ist einem Wahnsinn ähnlich, hier wird der Gerechtigkeit genüge getan, denkt er, Auge um Auge, Zahn um Zahn; in Dreiteufelsnamen, so kommt doch, ihr verdammten Deutschen! In einem parallelen Gedanken sieht er vor sich, wie er in wenigen Wochen bei der Rückkehr König Haakons als Ehrenwache am Ostbahnhof Aufstellung nimmt – der König in einer Eisenbahn, gezogen von der Dovregubben – und die Leute sich gegenseitig zuflüstern: »Das ist Harald Keller, der Kriegsheld!«
Um ein Überhitzen der Waffe zu verhindern und Munition zu sparen, die immer knapper wird, feuert er nur kurze Salven. Der deutsche Beschuss, das Pfeifen der Kugeln, wird weniger. Keiner ist über den Fluss gekommen. Harald lässt den Kopf sinken, sieht sich um, und sein Blick trifft auf all das Rot im Schnee vor dem benachbarten Posten, Spuren von Alf, der von zwei Vorgesetzten auf einen Mantel gelegt und weggeschleift worden war.
Der Geruch von Schießpulver, heißem Metall, Blut, Tod.
Den Rest des Tages herrschte Stellungskrieg. Die Deutschen sorgten dafür, dass sie sich nicht rühren konnten, eröffneten bei der kleinsten Bewegung das Feuer. Du bohrst in der Nase, und in der nächsten Sekunde ertönt ein Pfff über deinem Kopf und an dem Baum hinter dir verschwindet ein Zweig. Wie viele waren es? Der Hauptmann schätzte sie auf tausend, unmöglich zu wissen.
Erst jetzt spürte Harald den Hunger. Ein saftiges Beefsteak! Er hatte seit dem Vorabend nichts gegessen. In der Tasche hatte er noch immer den harten Brotkanten stecken, er saugte mehr daran, als dass er kaute, während er die Gerichte aus der Speisekarte vor sich sah, die er tagtäglich im Theatercaféen serviert hatte. »Hummerpastete« … »Tournedos mit Champignons« … »Schneehuhn mit Kompott« … »Pfirsich Melba« …
Einige Sekunden lang – in seiner Vorstellung war dies unmittelbar ein schwarzer Moment – musste er daran denken, dass er hier lag und auf Menschen schoss, die er bis vor wenigen Wochen noch als seine Gäste betrachtet und mit einem Lächeln bedient hätte, wenn sie als Touristen nach Oslo gekommen wären. Deshalb liebte er das Theatercaféen. Es war ein Treffpunkt. Nicht nur ausländische Reisende kamen dorthin, sondern ebenso Diplomaten und Journalisten aus allen Ländern. Dazu Schriftsteller, Künstler, die norwegische Geisteselite. Es war, als befände man sich mitten in einem Dynamo, einem Energiezentrum.
Bücher. Eines Abends hatte er ein Gespräch mitgehört, bei dem ein Gast den anderen am Tisch Sitzenden etwas über den Wissenschaftler Albert Einstein erzählt hatte. Vor einigen Jahren habe Einstein dem Psychoanalytiker Sigmund Freud einen offenen Brief geschrieben, der später, zusammen mit Freuds Antwort, als kleines Büchlein erschienen sei. Während der Diskussion hatte der Gast mit dem Buch herumgewedelt wie mit einer weißen Flagge, und als sie gegangen waren, hatte er es Harald überreicht, wie als Geschenk für einen Gleichgesinnten – und Harald hatte es gelesen.
»Was hat Einstein geschrieben?«, fragte Maud später, ausgerechnet an jenem Tag, als sie bei der Festung Akershus spazieren gingen und leichte Schneeflocken die Luft erfüllten.
»Er fragt, ob es möglich ist, die Menschheit von dem Unglück zu befreien, das der Krieg mit sich bringt«, sagte Harald. »Er hat den Traum, dass die Macht der Ideen einst stärker sein wird als die Macht der Gewalt. Die Kultur stärker als die Natur, der Gerechtigkeitsgedanke stärker als die Wirtschaftsinteressen.«
»Das wird wohl ein Traum bleiben«, sagte sie. »Die irrationalen Seiten des Menschen werden immer stärker sein als die rationalen. Leider.« Schweigend spazierten sie weiter, doch dann blieb sie plötzlich mitten am Festungsplatz stehen und senkte die Augenlider: »Und jetzt lebt Einstein nicht mehr in Deutschland und Freud nicht mehr in Österreich«, sagte sie. »Beide mussten fliehen.«
Es wunderte Harald, woher sie das wusste. Er selbst war sich nicht darüber im Klaren gewesen, dass Freud im Exil lebte, trotz seiner Begeisterung für Wien, die Hauptstadt der Kaffeehäuser.
Aber seine Mutter hatte schon recht, er las viele belletristische Werke. Er kaufte oft Bücher im Alhambra, dem Antiquariat, das sein Großvater mütterlicherseits in der Kirkegata gegründet hatte. Einmal hatte er den Pfarrer Konrad Steen, einen Kindheitsfreund seiner Mutter, dort getroffen. Harald hatte sich immer gefragt, in welcher Beziehung die beiden zueinander standen, ob es etwas mehr war als nur Freundschaft. Jedenfalls schrieb Konrad Steen in den Zeitungen oft über Literatur, Harald hatte den Eindruck, dass er genauso viele Bücher gelesen haben musste wie Sigurd Hoel, der es im Übrigen vorzog, im Restaurant Annen Etage des Hotel Continental zu sitzen, auch wenn Harald ihn mitunter in der »Künstlerecke« des Theatercaféen hatte vorbeischauen sehen. Im Alhambra hatten Harald und Konrad ihre Ansichten über Ein Flüchtling kreuzt seine Spur von Aksel Sandemose ausgetauscht, ein Buch, das Harald mit Neugier gelesen hatte, nachdem ein älterer Kellner behauptet hatte, er sei dabei gewesen, als Sandemose im Theatercaféen das Romanmanuskript, einen ganzen Koffer voll, an jenen Verleger übergeben hatte, der das Buch schließlich herausbrachte, nachdem es von den beiden Großverlagen Gyldendal und Aschehoug abgelehnt worden war. »Das macht den Roman ja nur noch besser«, hatte Konrad lachend angemerkt, als Harald ihm die Anekdote erzählt hatte. Davor hatte Harald schon mit Maud über Sandemoses Buch diskutiert, in ihrer Hütte in der Nordmarka, aber ihr gefiel der Roman nicht. Sie waren darüber in Streit geraten, und es hatte sich herausgestellt, dass sie den Roman deshalb nicht mochte, weil sie dessen Verfasser nicht leiden konnte. »Ein unsympathischer Mensch. Ich lese keine Romane von amoralischen Schweinigeln, egal wie gut ihre Bücher sind«, hatte sie gesagt und dabei langsam geblinzelt, wie immer, wenn sie etwas sehr ernst nahm. Harald hatte an die vielen Male gedacht, als er Sandemoses ungehobeltes Benehmen im Theatercaféen mitangesehen hatte, seine unaufhörliche Jagd nach Frauen, es aber nicht erwähnt, weil er ihr nicht recht geben, sondern ihr lieber von Ronald Fangen erzählen wollte, einem Schriftsteller, den er oft bedient hatte und von dem er wusste, dass sie ihn mochte.
»Grüß deine Mutter«, hatte Konrad Steen beim Gehen gesagt, begleitet vom Läuten der kleinen Türglocke.
Harald fiel ein, dass er vergessen hatte, die Grüße auszurichten.
Im Café Agora, dem Lokal, das Harald eröffnen und zu einem natürlichen Versammlungsort für junge wissbegierige Menschen machen wollte, sollte es nicht nur Zeitungen geben, in- und ausländische, sondern auch eine Bücherwand. Es sollte ein Café werden, in dem es Bücher gab, die in so vielen verschiedenen Sprachen geschrieben waren, wie sie von den Besuchern gesprochen wurden. Alles, was man dazu dann noch brauchte, war ein Silbertablett mit einer Tasse Kaffee und einem Glas Wasser. Begeisterte Gespräche. Junge Männer, oder selbstbewusste Frauen wie Maud, mit Koffern voller brillanter Ideen. Nach seiner Ansicht, und darin stimmte ihm sogar seine Mutter zu, hatte die Aufklärungszeit in den Kaffeehäusern ihren Anfang genommen.
Warum also lag er hier und schoss auf Deutsche?
Was für ein Kontrast: In dem einen Augenblick servierst du Kaffee, im nächsten tödliches Metall.
An seinen Großvater, einen deutschen Architekten, der Eisenbahnstationen in Norwegen entworfen hatte, konnte er sich nur dunkel erinnern. An sein seltsames Norwegisch, sein Zäpfchen-R. An ein Haus, oder den Teil eines Hauses, in Homansbyen. Was ihm am deutlichsten im Gedächtnis geblieben war, waren die Figuren, die der Großvater aus einem weißen Taschentuch basteln konnte. Einen Hasen, der über den Schnee hoppelte. Und an seine Zeichenkünste. Ein strenger Mann, der zum Kind wurde, sobald er zu zeichnen anfing.
Harald fingerte am Maschinengewehr herum. Warum dachte er jetzt an das alles? Obwohl er hier saß und Ausschau hielt nach jemandem, den er töten konnte, rasten die Gedanken dahin. Vielleicht lag ja ein Architekturstudent auf der anderen Seite des Flusses. Einer, der einfach nur zeichnen wollte, Bahnhofsgebäude, Kaffeehäuser, der aber gezwungen war, ein Gewehr zu bedienen.
So durfte man unmöglich denken. Er musste den Zorn aufrechterhalten.
Die letzten vierundzwanzig Stunden hatte er sich nach Kaffee gesehnt. Mehr als nach etwas zu essen. Er hätte wer weiß was gegeben für eine Tasse Kaffee. Wieder schweiften seine Gedanken ab. Er sah seine Großmutter vor sich, eine alte Dame, die Østerdal-Dialekt sprach und in ihrer Küche in Homansbyen mit einer Mühle, einem Holzwürfel mit goldener Kuppel, Kaffee mahlte, und während die Kurbel sich gleichmäßig im Kreis drehte und die Bohnen knirschten, breitete sich der Kaffeegeruch im Zimmer aus. Sein Vater, Otto Keller, hatte immer begeistert davon gesprochen, dass seine Verwandtschaft mütterlicherseits aus Østerdalen stammte; über mehrere Generationen hatte der Wald für ihren Lebensunterhalt gesorgt, auch durch die Jagd. »Und hier sitze ich nun«, hatte Haralds Vater gesagt, »und zeichne Pläne für Lokomotiven! Was für ein Werdegang!« Und ich, ja, ich bin ins Jägerdasein zurückgekehrt, dachte Harald. Mit dem Unterschied, dass ich auf Menschen schieße. Er verspürte ein unbändiges Verlangen nach Kaffee. Wieso lagen sie hier und ballerten sich gegenseitig nieder? Es fehlte nicht viel, und er wäre aufgestanden und hätte gerufen: Ich gebe eine Tasse Kaffee aus! Lasst uns die Waffen niederlegen! Lasst uns Kaffee trinken, reden, lasst uns dieser Bestialität ein Ende setzen!
Unmöglich. Den Zorn aufrechterhalten.
Endlich. Er glaubte zuerst, es wäre eine Halluzination, aber es war wirklich: Zwei Männer kamen herangekrochen, einen großen grauen Eimer zwischen sich. Der Nachschubweg, oder zumindest Teile davon, mussten demnach unversehrt geblieben sein. Lang lebe das norwegische Heer! Wenn sie schon kein Essen bekämen, so bekämen sie wenigstens Kaffee. Er nahm ihn begierig entgegen. Dünner, schlechter Kaffee – er hatte nie besseren getrunken. Er schielte zu den anderen, die mit seligen Gesichtsausdrücken ihre Metallbecher zwischen den Händen hielten. Vorläufig blieb ihm nichts anderes, als mit dieser durchkämpften, patronenübersäten Schneelandschaft inmitten von Fichten als seinem Café Agora vorliebzunehmen.
Als ob das eine das andere bedingte, brachte der Geschmack des Kaffees das Bild eines Buches mit sich. In der Dunkelheit, im Schnee sitzend, sehnte er sich nach einer warmen Stube, einem Kamin, einem bequemen Sessel, einem Buch, vielleicht Anna Karenina – die Stelle, in der dem undankbaren Schwein Wronskij sein Glück, seine Verliebtheit, bereits wieder abhandengekommen ist. Was ihn betraf, hätte er genauso gut hier lesen können, sofern ihnen die Benützung einer Taschenlampe erlaubt gewesen wäre; er konnte überall lesen, viele Bücher hatte er sogar in der Krone der Eiche draußen vor der Villa Bohre gelesen. Maud war genauso. Ernsthaft in sie verliebt hatte er sich, als er sie letzten Sommer in ihrer Hütte beim Lesen beobachtet hatte. Sie hatte ein Buch aus dem kleinen Bücherregal gezogen, sich damit jedoch nicht aufs Sofa begeben, sondern es einfach in dem Regal darunter an eine freie Stelle gelegt und im Stehen gelesen, lange, als ob das, was sie las, ihr jede Regung unmöglich machte. Stunden später war er Zeuge einer weiteren Variante geworden. Nach dem Essen – Forellen, die sie selbst im Teich gefangen hatte, gefüllt mit Zitrone, Mandeln und Dill – hatte sie zunächst den Tisch saubergewischt. Dann ging sie hinaus, um ein paar Waldblumen zu pflücken, die sie in einer Vase auf den Tisch stellte. Sie schenkte sich eine Tasse Kaffee ein, dazu ein kleines Glas Krähenbeeren-Likör, setzte sich an den Tisch und drehte den Stuhl so, dass sie auf das Wasser hinaussehen konnte. Danach schlug sie das bereitliegende Buch auf und las darin, völlig versunken. Nach einigen Minuten drehte sie sich um und entdeckte, dass er sie beobachtete, sicher mit einem verrückt-verliebten Lächeln um den Mund. »Leser können genauso viele Rituale beim Lesen haben wie Schriftsteller beim Schreiben«, sagte sie.
Maud. Er sehnte sich nach ihr. So sehr, dass sich alles in ihm zusammenzog. Dann wieder dieser Erinnerungsblitz, eine Erinnerung, die er am liebsten vergessen wollte. Der Hüttenausflug, der verhängnisvolle Abend. Er hatte die Hütte verlassen. Hatte unter Fichten gesessen, so wie jetzt bei der Brücke bei Fossum. Mit dem Unterschied, dass er jetzt keine Scham empfand. Denn es war die Scham, die an ihm genagt hatte in dieser Nacht im Kroksogen. Er hatte Jacke und Rucksack geholt, die Skier angelegt und war nach Hause gelaufen, im Mondlicht. Mehrmals war er gestürzt, hätte sich fast verletzt, aber er musste weg, hätte ihren Blick am nächsten Morgen nicht ertragen können.
Gegen Mitternacht entdeckte er auf einmal mehrere unbekannte Gesichter. Er hörte die leise Stimme des Fähnrichs irgendwo hinter sich, der fragte, ob er abgelöst werden wolle. Harald verneinte. Geir? Auch er verneinte. Sie grinsten einander zu. Etwas Ekstatisches lag in Geirs Augen. Sie waren ein gutes Team. Jetzt mit noch mehr Munitionskästen. Zweieinhalb Tage und Nächte lagen sie jetzt hier, fast ohne Ruhe und Schlaf und in großer Anspannung, und trotzdem wollten sie hierbleiben, als wüssten sie, dass eine entscheidende Schlacht bevorstand. Noch immer dachte Harald keine Sekunde daran, dass er getötet werden könnte, auch daran nicht, wie er, in einer fernen Zukunft, seinen Kindeskindern, die ihm mit großen Augen Fragen stellten, von alldem erzählen würde. Wie die meisten sah er einen Tod in hohem Alter vor sich, und dass man, wenn die Stunde geschlagen hatte, von der Familie, von Freunden umgeben war und einem noch Zeit bliebe, etwas Kluges zu sagen, bevor man den Becher leerte. Wie Sokrates. Ja, wie ein norwegischer Sokrates, Besitzer des berühmten Café Agora.
Am meisten aber fantasierte er davon, wie er bald wieder seine Hände um Mauds Kopf legte, wie seine Finger sich beim Einschlafen in ihre dunklen Locken wickelten. Und dann musste er wirklich eingeschlafen sein, denn die Stimme des Hauptmanns holte ihn mit einem Schlag wieder zurück, sie ertönte hinter ihnen, aber so leise, dass nur die zwei nächstgelegenen MG-Stellungen sie hörten. Harald bekam nicht alles mit, konnte aber einige aufmunternde Sätze heraushören, zurückhaltende Worte, bei denen ihm, und offenkundig auch Geir, dennoch ein Schauer feierlicher Entschlossenheit über den Rücken lief.
Wieder die Wut. Der blinde Zorn. Auf der Anhöhe dort drüben lag der Feind, der das Land an sich reißen wollte!
Kommt nur, dachte er und spürte etwas in sich, das dem vergleichbar sein musste, worüber er in den Knabenbüchern gelesen hatte: Blutdurst. Wieder sah er Alf vor sich, sein malträtiertes Gesicht. Er wollte töten. Töten, töten, töten. Ein Singen im Körper, ein Verlangen nach Blut. Kommt nur! Als die Deutschen kurz darauf Leuchtgranaten abschossen und von der Anhöhe herab ein heftiges Feuergefecht einleiteten, war er nichtsdestoweniger überrumpelt. Die norwegischen Stellungen lagen in Licht gebadet, die des Feindes hingegen konnten sie nicht sehen, sahen nur, dass die Deutschen nicht mehr in ihren Stellungen lagen, sondern in großer Zahl über und unter der Brücke auf sie zukamen. Sogar noch während er das MG langsam von links nach rechts schwenkte, fiel ihm auf, wie durch die in der Luft über ihnen hängenden Leuchtgranaten alles ins Künstliche getaucht wurde und die Landschaft den Anstrich einer Theaterkulisse bekam.
Wieso befand er sich hier? Auf dieser Bühne? Wieso war er nicht bei Maud?
Er ist taub, er sieht die Lichtblitze, einen nach dem anderen, aber er hört nichts. Denkt auch nicht nach. Kugeln schnellen an ihm vorbei, wie eine Ahnung nur oder wie ein leichter Geruch nach heißem Metall. Kommt nur! Ich bin unsterblich! Ich weiß, heute Nacht ist das Schicksal auf meiner Seite! Mit vielen Dingen gleichzeitig beschäftigt, bemerkt er, dass die Jungs aus seinem Team im Begriff sind, die Stellung zu verlassen, etwas weiter weg geht ein norwegischer Soldat zu Boden. Ok, hier hatten sie vielleicht verloren, sie mussten zum Rückzug blasen, doch dasselbe galt wohl kaum für alle anderen Einsatzorte, an denen Norweger mit aller Macht ihr Land verteidigten, und wenn die Deutschen dort genauso viele Männer und genauso viel Zeit benötigten wie für das Vordringen über die jämmerliche Brücke bei Fossum, dann waren sie chancenlos. Wieder eine Leuchtgranate. Wie eine gigantische Glühbirne, direkt über ihnen. Wie eine Enthüllung. Die Enthüllung einer Illusion. Und inmitten eines nur halb erhaschten Gedankens, dass er, Harald, Teil einer Erzählung ist, die ihren Platz in den Geschichtsbüchern finden wird, einer Erzählung über Norwegens heldenmutigen Kampf, den machtvollen Widerstand, den dieses Geburtsland der Recken den Deutschen entgegensetzte, wodurch das Nazipack sich gezwungen sah, zu den Schiffen zurückzukehren – irgendwo inmitten dieser Gedankensplitter erkennt Harald, dass ein Gefühl alle anderen in den Hintergrund drängt, und dass dieses Gefühl Angst ist. Eine Angst, die tief in seine Seele hinabführt. Die Angst ist so groß, dass er beinahe die Krag verliert, als er nach ihr greift und rückwärts durch den Schnee zu laufen beginnt, zu kriechen eigentlich, doch nach nur wenigen Schritten schlägt etwas in seinem Bein ein und lässt ihn einknicken. Er ist getroffen, kann aber nicht begreifen, dass sich das so anfühlt, es ist, als hätte jemand ihm ein Schwert ins Bein geschlagen. Eine Sense aus iberischem Stahl.
Er schrie vor Schmerz – oder war es Angst? – und sackte zusammen, doch in seinem Kopf tönte die Stimme seiner Mutter: Steh auf!, und er kam wieder auf die Beine, ist ja nur ein Kratzer, dachte er, so viel musste man schon zu opfern bereit sein für einen Sieg. Dann hatte er plötzlich doch Angst, aber gerade die Angst würde ihm dabei helfen, sich hinkend in Sicherheit zu bringen. Er würde verflucht nochmal die Kong-Haakon-Medaille entgegennehmen! Er und Sigurd. Die Bohre-Brüder, die Kriegshelden! Und er musste seiner Mutter noch die Grüße von Konrad Steen ausrichten. Im Sommer würde er mit Maud Blaubeerkuchen in ihrer Hütte im Krokskogen essen. Er feuerte alle fünf Schuss aus dem Magazin gegen Schatten, die vom Fluss kamen, einer davon fiel immerhin; mit steifen Fingern, zitternd vor Angst, pulte er fünf neue Patronen aus einer der Gürteltaschen, legte sie ins Magazin ein und lief, humpelte von der Anhöhe fort. Kugeln schlugen um ihn herum ein, die Deutschen mussten herübergekommen sein, sie waren jetzt ganz in der Nähe, Maschinenpistolensalven ertönten, Harald drehte sich um und schoss mit dem Karabiner, schoss einfach ins Blaue hinein, sah nichts, hatte keine Zeit zum Nachladen, lief einfach, lief aus purer Angst, er hörte deutsche Rufe, er verstand ein bisschen Deutsch, konnte aber trotzdem nicht verstehen, was sie riefen, wusste nicht, ob es ihnen galt oder ob es Befehle an ihre deutschen Landsleute waren, ein heftiges Knallen erklang hinter ihm, die Teufel hatten Handgranaten, Licht flackerte zwischen den Stämmen auf, als wäre ihm ein feuerspeiendes Monster auf den Fersen.
Wusste er, dass er getötet werden würde? Dass er sterben würde? Dass die Dovregubben, das schwarze Ungeheuer, zu guter Letzt doch noch gekommen war, um ihn zu holen? Sich pausenlos umwendend, wie um zu sehen, wer den tödlichen Schuss abgeben würde, lief er fast rückwärts, rutschte im Schnee aus auf der Straße, die nach Askim führte. Er kam am Hauptmann vorbei, erschossen. Harald dachte, dass er sich selbst etwas vorgemacht hatte, seine Angst sagte es ihm. Der ganze Unsinn von wegen Mut. Von wegen Widerstand. Er hätte es machen sollen wie die anderen. Dafür sorgen, dass er am Leben blieb. Seiner Mutter zuliebe. Maud zuliebe. Nicht den Helden spielen, wie er es jetzt tat, ein Held, der sich vor Angst fast in die Hosen machte. Er kniete sich hin, konnte ein paar Patronen einlegen, legte das Gewehr an, sah mehrere Schatten auf sich zulaufen, konnte Helme sehen, erkannte sie als deutsche, er schoss in Panik, keine Schatten fielen, Schusssalven ertönten, und da, da kam sie, er konnte sie auf ihrem Weg beobachten, sah die Kugel auf seine Stirn zufliegen, sah sie in der Luft vor sich anhalten, als wollte sie ihm Zeit geben für einen letzten Gedanken, aber es stimmt nicht, dass in einem letzten dramatischen Augenblick das Leben an einem vorbeizieht, sondern stattdessen bleibt die Zeit stehen, gibt einem Gelegenheit zum Nachdenken, so lange nachzudenken, wie man will, sein ganzes Leben zu durchdenken, jede Sekunde, wenn man das wollte, doch Harald ist müde, ihm fehlt die Kraft dazu, er entdeckt einen Fichtenzweig am Wegesrand, seltsam deutlich in dem Lichtschein der über ihnen hängenden Leuchtgranaten, er sieht die feine Struktur, die mit einer dünnen Frostschicht überzogenen Nadeln; und bevor die Kugel weiter auf seine Stirn zusteuert, klammert er sich, wie im Triumph, in Gedanken an Maud fest, an sie, die das Einzige ist, was ihn jetzt noch kümmert, an seine Liebe zu ihr und daran, wie traurig es ist, ohne Vergebung zu sterben, und dann, fast mit einem Nicken, nimmt er das todbringende Blei entgegen und entschwindet.
Aus dem Norwegischen von Bernhard Strobel.
© Septime Verlag, Wien 2020
* * *
