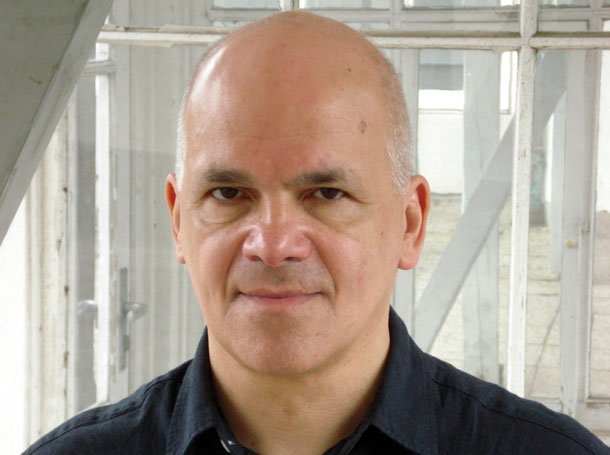
Foto: Maja Bechert
Zwei Monate nach dem Tod meines Vaters hatte ich einen Traum: Aus einer erhöhten Perspektive näherte sich mein Blick durch den morgendlichen Dunst eines ersten Frühlingstages einer Siedlung mit bungalowartigen Einfamilienhäusern, wie sie Ende der Sechzigerjahre modern wurden. Er streifte suchend über die Dächer und senkte sich schließlich in eine Straße, die in einem Wendehammer endete, wo er vor einem Haus mit einer großen Blauzeder im Vorgarten anhielt. Wie eine Ansichtskarte, die etwas zeigt, das einem so vertraut ist, dass es als Abbildung fremd bleiben muss, fror dieses Bild ein, während der Blick ins Innere des Hauses drang und sich dort mit meinem Körper verband, der, gerade erst aufgestanden, vom Schlafzimmer in Richtung Küche ging, wohl, um sich dort einen Tee zu machen. Bevor ich jedoch die Küche erreichte, fiel mir ein, dass ich seit Längerem versäumt hatte, nach dem Haus meiner Eltern zu sehen, das sich direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite befand und seit ihrem Tod leer stand. Ich ging zur Garderobe, zog mir einen Mantel über, nahm den Schlüssel mit den Initialen E. H. aus dem Schlüsselkasten, verließ das Haus und eilte hinüber. Bereits beim Öffnen der Tür und Eintreten in den Flur bemerkte ich, dass die Wohnung leicht überhitzt war. Ich dachte an die Kosten, die das verursachen würde, und ärgerte mich, die Heizung nicht abgedreht zu haben. Zögerlich, da mir die Umgebung völlig unbekannt zu sein schien, ging ich den Flur entlang bis zu einer Treppe, die nach oben, wahrscheinlich zum Speicher führte, jedoch nicht zu betreten war, weil die unterste Stufe direkt an der Wand ansetzte, in der auch die Geländer verankert waren. Vergeblich versuchte ich einen Zugang zu finden, wandte mich schließlich ab und ging zur Wohnzimmertür. Als ich sie öffnete, schlug mir eine stickigere, streng riechende Luft entgegen. Vorsichtig betrat ich den Raum, dessen Mobiliar von der Zimmermitte an die Wände geschoben war, so, als hätte man für etwas Platz schaffen wollen. Gerade war ich im Begriff, die Tür hinter mir zu schließen, als mir langsam und erschöpft ein lebensgroßes, jedoch völlig abgemagertes Rhinozeros entgegenkam. Erst in dem Moment fiel mir mit Schrecken ein, dass ich nicht nur dieses Rhinozeros, sondern auch die fünf Hunde meiner Eltern zu füttern und mit Wasser zu versorgen vergessen hatte. Keinerlei Geräusche waren zu hören und auch das Rhinozeros verharrte eigenartig still und unbeweglich vor mir, fast, als habe es nur so lange ausgeharrt, um nun vor meinen Augen zu verenden. Vorsichtig schaute ich mich im Zimmer um, da ich befürchtete, etwas Ekelerregendes, etwa eine Reihe von Kadavern, zu entdecken. Und tatsächlich entpuppte sich das, was ich aus einiger Entfernung anfänglich für Teppichvorleger gehalten hatte, im Näherkommen als ausgetrocknete Fellreste. Zu meinem großen Entsetzen befand sich an einem dieser Felle der noch lebendige Kopf eines Hundes. Ähnlich wie das Rhinozeros rührte auch er sich kaum, sah mich nur traurig an und bewegte stumm die ausgetrockneten Lefzen. In Panik rannte ich aus dem Haus und hinüber zu mir, von wo aus ich eine Freundin anrief, die mir versprach, sofort einen Veterinär zu verständigen.
Dass sich der vierzigjährige Adorno als „Archibald Stumpfnase Kant von Bauchschleifer“ bezeichnet und seine Mutter als „Marimumba, meine Stutensau“, verweist auf eine derart vor-ödipale Naivität, dass man als Außenstehender nur ungern daran teilhaben möchte.
Obwohl der Traum intensiv war und ich verstört aus ihm erwachte, hatte ich nicht die geringste Lust, mich weiter mit ihm zu beschäftigen. Die letzten Monate meines Wachzustandes waren anstrengend genug gewesen, und auf weitere Einblicke in den konfusen Zustand meiner Psyche konnte ich momentan gern verzichten. Es gibt Traumbilder, die etwas zusammenfassen, auf das man von allein niemals gekommen wäre, hier aber hatte ich das Gefühl, einem fremden Traum beigewohnt zu haben, einer filmischen Inszenierung, die mit billiger Effekthascherei arbeitete. Meine Eltern waren nicht mehr am Leben, das stimmte, allerdings hatten sie ihr Haus bereits zwei Jahre vor ihrem Tod verlassen und waren in ein Seniorenheim gezogen. Auch wohnte ich nicht in ihrer Nähe, schon gar nicht in derselben Straße. Am hervorstechendsten, neben der Bezeichnung Rhinozeros, die mein träumendes Ich verwendet hatte, während ich normalerweise Nashorn sagen würde, war die Erscheinung dieses Tiers, das in seiner aufdringlichen Symbolik einem billigen Ratgeber zur Deutung von Träumen entstiegen schien. Sollte es das versinnbildlichen, was ich unwissentlich vernachlässigt und damit dem Tod überantwortet hatte, das, was ich in meinem Verhältnis zu meinen Eltern bislang nicht hatte sehen wollen oder können?
Das Stück Rhinocéros von Ionesco fiel mir ein, das ich nur dem Namen nach kannte. Ich widerstand der Versuchung, nachzuschauen, von was genau es handelte, denn was könnte sich daraus schon für mich erschließen, selbst wenn mir wieder einfallen würde, doch vor vielen Jahren einer Inszenierung beigewohnt und diesen Abend in der Zwischenzeit lediglich vergessen zu haben? Als Nächstes erinnerte ich mich an eine Erzählung Bertrand Russells, in der er eine seiner ersten Begegnungen mit Wittgenstein beschreibt. „Mein deutscher Ingenieur ist, befürchte ich, ein Narr. Er vertritt die Meinung, nichts Empirisches sei erfassbar. Ich bat ihn zuzugeben, dass sich kein Rhinozeros im Raum befände, doch selbst das lehnte er ab.“ Wie leicht schien es mir nach diesem Traum, zuzugeben, dass sich kein Rhinozeros im Raum befindet, verglichen mit der umgekehrten Erkenntnis seines Vorhandenseins, noch dazu im Zustand der Agonie, die man mehr oder minder selbst verschuldet hatte. Unwillkürlich drängte sich mir eine Parabel in dem Sinne „Weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!“ auf, doch gelang es mir nicht, diese Konstruktion auch nur ansatzweise zu durchdenken und in Worte zu fassen. Ein Zustand, der mir in meinem momentanen Alltag, und nicht nur in Bezug auf meine Träume, mittlerweile recht vertraut war.
Plötzlich sah ich mich nicht einmal mehr imstande, mit ein, zwei Sätzen in meinem Kalender zu notieren, was ich am jeweiligen Tag unternommen hatte, wie es sonst meine Angewohnheit war.
Ich hatte relativ bald nach dem Tod meines Vaters angefangen, mir einige Dinge zu notieren und war deshalb in einen unausgesprochenen Konflikt mit meiner Therapeutin geraten, da ich das Gefühl hatte, sie akzeptiere diesen Schreibvorgang nicht als eine angemessene Form der Trauerarbeit, und mir bereits der Begriff „Trauerarbeit“ problematisch erschien, denn wenn ich etwas nicht verspürte, war es Trauer, und wenn ich auf etwas keinen Wert legte, war es zusätzliche Arbeit. Ich hatte beim Tod meiner Mutter vor zwei Jahren keine Trauer
Dieser Beitrag ist nur für Abonnenten zugänglich. Bitte melden Sie sich in Ihrem Konto an, oder wählen Sie eines der drei unten stehenden Abos, um sofort weiterzulesen.
Das erfolgreichste, weil intellektuell beweglichste Literaturblatt unserer Tage*
– für den Preis von einem Espresso im Monat.
Förder-Abo
€ 9,00 / Monat
(Mindestlaufzeit: 12 Monate)
- Zugang zu allen Online-Beiträgen
- Printausgabe (4 Hefte / Jahr)
- E-Paper-Ausgabe (4 Hefte / Jahr)
- 300+ Online-Beiträge / Jahr
- Online-Leseproben und Vorabdrucke
- Zugang zu E-Paper-Ausgaben im Archiv
- Zugang zu ca. 2000 Beiträgen im Archiv
- Tägliche Presseschau
- Newsletter
- Novitäten-Telegramm
- Preis-Telegramm
- Ausschreibungen
- Ausgewählte VOLLTEXT E-Books
- Ausgewählte VOLLTEXT Specials
Digital
€ 2,00 / Monat
(Mindestlaufzeit: 12 Monate)
- Zugang zu allen Online-Beiträgen
- E-Paper-Ausgabe (4 Hefte / Jahr)
- 300+ Online-Beiträge / Jahr
- Online-Leseproben und Vorabdrucke
- Zugang zu E-Paper-Ausgaben im Archiv
- Zugang zu ca. 2000 Beiträgen im Archiv
- Tägliche Presseschau
- Newsletter
- Novitäten-Telegramm
- Preis-Telegramm
- Ausschreibungen
Print & Digital
€ 3,00 / Monat
(Mindestlaufzeit: 12 Monate)
- Zugang zu allen Online-Beiträgen
- Printausgabe (4 Hefte / Jahr)
- E-Paper-Ausgabe (4 Hefte / Jahr)
- 300+ Online-Beiträge / Jahr
- Online-Leseproben und Vorabdrucke
- Zugang zu E-Paper-Ausgaben im Archiv
- Zugang zu ca. 2000 Beiträgen im Archiv
- Tägliche Presseschau
- Newsletter
- Novitäten-Telegramm
- Preis-Telegramm
- Ausschreibungen
* Saarländischer Rundfunk
FAQ
Wie kann ich ein VOLLTEXT-Abonnement verschenken?
Sie können alle VOLLTEXT-Abonnements befristet oder unbefristet verschenken. Die Mindestlaufzeit beträgt ein Jahr. Danach kann das Abonnement auslaufen oder wahlweise durch die Schenkenden oder die Beschenkten verlängert werden.
–> Bestellinformationen
Was sind E-Paper-Ausgaben?
E-Paper-Ausgaben entsprechen 1:1 der gedruckten Zeitschrift. Abonnenten erhalten nicht nur Zugriff auf die jeweils aktuelle Ausgabe, sondern auch auf ältere Hefte im Archiv (gegenwärtig alle Ausgaben seit 2016).
Gibt es Kündigungsfristen?
Nein, Sie können das Abonnement jederzeit formlos per E-Mail oder Post kündigen.
Ich bin bereits Abonnent der Printausgabe und möchte Zugang zu den Online-Beiträgen, wie komme ich dazu?
Wenn Sie bereits über ein Online-Konto auf Volltext.net verfügen, können Sie mit Ihrem bisherigen Passwort auf die Beiträge hinter der Paywall zugreifen.
Ich kann die heruntergeladenen E-Paper-Ausgaben nicht öffnen.
Die E-Paper-Ausgaben sind mit einem Passwort geschützt. Informationen zum Passwortschutz finden Sie nach der Anmeldung auf der Startseite Ihres Online-Kontos.
Wo finde ich mein Online-Konto?
Am oberen, rechten Rand des Bildschirms finden Sie einen Link „Mein Konto“, über den Sie sich einloggen können.
