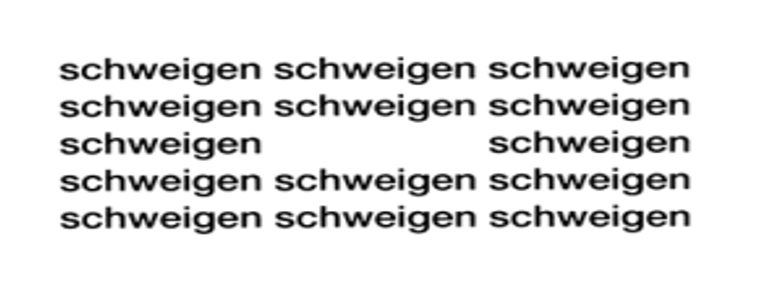Nach Gottfried Keller und Conrad Ferdinand Meyer, neben Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt ist Eugen Gomringer – er schreibt sich konsequent mit Kleinbuchstaben: eugen gomringer – der einzige „Schweizer Autor“, der den Status eines Klassikers erreicht und als solcher Eingang nicht nur in die nationale Literaturgeschichte gefunden hat, sondern auch international in beliebig viele Zeitschriften, Anthologien, Schulbücher, Katalog- und andere Sammelwerke eingegangen ist. Eine Werkausgabe von Gomringers zahlreichen dichterischen und theoretischen Texten liegt bisher nicht vor, sie sind aber in wechselnder Zusammenstellung weithin verbreitet und gelten noch heute als Musterstücke „konkreter“ Poesie und Poetik.
Was Gomringer zeitgleich mit den „Zürcher Konkreten“ (Malerei, Architektur, Design), mit der „guten Form“ des Schweizerischen Werkbunds und der „neuen Basler Typografie“ seit den mittleren 1950er Jahren als „konstellationen“ darbot, waren Gedichte in Form von visuellen Texten oder Ideogrammen, Gedichte, die gleichermassen gelesen und gesehen und rezitiert werden können, die jeden Hermetismus unterlaufen (oder überbieten), indem sie nur einfach sehen lassen, was sie „bedeuten“ – zum Beispiel das Schweigen als Leerstelle in einem Gedichttext, der einzig aus dem mehrfach verwendeten Wort „schweigen“ besteht und also eine Konstellation bildet, deren Mitte ausgespart bleibt; die Liebe, die anagrammatisch aus den Wörtern „lieb“ und „leib“ entfaltet wird; der Wind, der sich als Letterngestöber aus dem Wort „wind“ erhebt. „Konkret“ sind solche Textgebilde zu nennen, weil in ihnen die Wörter, die Buchstaben als materiell und optisch wahrnehmbare Gegebenheiten Vorrang haben vor dem, was sie als Aussage mit sich tragen.
Die einzige „typisch“ schweizerische Prägung scheint für Gomringer „die Freude an der Disziplin“ gewesen zu sein, das hier verbreitete Ordnungs- und Nützlichkeitsdenken.
Bis in die frühen 1970er-Jahre konnte sich die konkrete Dichtung als intermedialer Epochenstil behaupten, praktiziert und propagiert von Autoren wie Heissenbüttel, Mon, Bense, Rühm, Gappmayr und manch andern, mit einer Anhängerschaft, die weit über den deutschen Sprachraum und über Europa hinausreichte. Von Beginn an war Eugen Gomringer als Verfasser zahlreicher Manifeste und Programmschriften der wortführende Exponent und auch einer der produktivsten Dichter der „Konkreten“, und noch als deren hohe Zeit längst vorüber war, blieb er ihnen als unermüdlicher Sachwalter und Archivar verbunden. Einhellig wird heute seine diesbezügliche Führungsrolle anerkannt und gewürdigt.
*
Gomringers langjährige Präsenz und Autorität im internationalen Kartell der „Konkreten“ lässt die Frage aufkommen, ob und inwieweit sein Werk wie auch er selbst tatsächlich der schweizerischen Literatur zuzuordnen ist. Wohl hat er den Grossteil seines Lebens in der deutschen (alemannischen) Schweiz zugebracht, ist hier zur Schule gegangen, hat hier studiert und hat hier – in Bern, Ascona, Frauenfeld, Sankt Gallen – seine ersten „konkreten“ Texte und dann auch das Programm der konkreten Poesie ausgearbeitet. Doch schweizerische (literarische) Quellen, Traditionen oder Themen dafür gab es nicht. Die entscheidenden Impulse gingen von der klassischen europäischen Moderne aus, von Mallarmé, Marinetti, Arno Holz, vorab jedoch vom niederländischen und russischen Konstruktivismus der Zwischenkriegszeit.
Die einzige „typisch“ schweizerische Prägung scheint für Gomringer (nach dessen eigenem Bekunden) „die Freude an der Disziplin“ gewesen zu sein, das hier verbreitete Ordnungs- und Nützlichkeitsdenken, das er nicht zuletzt als engagierter Armeeoffizier und nach dem Krieg als professioneller Werbefachmann in Anschlag brachte. Die eher befremdliche, aber durchaus passende und davon hergeleitete Losung „Kommandiert die Poesie!“ wurde in der Folge bestimmend für sein Schaffen. Gerade aus der selbstauferlegten Disziplinierung des Sprachmaterials und dessen ingeniöser typographischer Umsetzung erreichte Gomringer eine poetische Appellwirkung, die weit über die Dichtung hinausreicht und die das Elitäre zum Populären hin öffnet – seine zahlreichen Auftragstexte, etwa die Werbesprüche für die Warenhauskette ABM, und seine ausgefeilten poetischen Elaborate verdanken sich gleichermassen dieser asketischen, dabei stets auch spielerischen Selbstdisziplin.
Als Propagandabeauftragter der Schweizer Schmirgel- und Schleifindustrie, danach als Geschäftsführer des Schweizerischen Werkbunds und als Gründungsmitglied des schweizerischen Verbands für Industriedesign musste Gomringer seine dichterische Schreibarbeit drastisch reduzieren, ehe er sich 1967, „alle Schiffe“ hinter sich „verbrennend“, definitiv nach Deutschland absetzte. Dort allerdings auferlegte er sich neue anspruchsvolle Verpflichtungen als Firmenberater, Kunstkurator, Hochschuldozent und international gefragter Vortragsreisender. Während eines halben Jahrhunderts blieb er, ohne sein Werk wesentlich zu erweitern, unentwegt tätig, veranstaltete Lesungen und Ausstellungen, veröffentlichte als Herausgeber Dutzende von Büchern und dokumentierte akribisch den Nachlass der „Konkreten“ wie auch seine eigene literarische Hinterlassenschaft; diese ist 2018 ins Schweizerische Literaturarchiv übergeführt worden.
*
Mehr als die Hälfte seines langen Lebens hat Eugen Gomringer als kosmopolitischer Exilant fernab seiner schweizerischen Heimat verbracht, vorwiegend in Westdeutschland, von wo aus er immer wieder weltweit unterwegs war. Dass er Deutsch bis ins hohe Alter mit leichtem schweizerischem Akzent sprach und bis zuletzt auch an der helvetischen Arbeits- und Formdisziplin festhielt, bezeugt seine fortdauernde Verbundenheit mit dem viersprachigen Kleinstaat. Wenn er in einem seiner bekanntesten Dialektgedichte („schwiizer“, Erstdruck 1969) den schweizerischen Charakter prototypisch herausstellt, gibt er sich damit nicht ohne Ironie auch selbst zu erkennen:
schwiizer
luege
aaluege
zueluege
nöd rede
sicher sii
nu luege
nüd znäch
nu vu wiitem
ruig bliibe
schwiizer sii
schwiizer bliibe
nu luege
Abseits stehen, neutral und „ruhig“ bleiben, sich „sicher“ fühlen, „von weitem“ zusehen, nicht „mitreden“ wollen – das sind lauter passive Qualitäten, die man der Schweiz als Unentschiedenheit, gar als Feigheit vorwerfen, aber auch als kluge Vorsicht gutschreiben kann. In einem bekenntnishaften späten Interview hat Gomringer zur Entstehung des Gedichts klar festgehalten: „Eigentlich wollte ich ein Selbstporträt verfassen, aber es wurde geradezu zu einem heimlichen Schweizerpsalm. […] Das darin angesprochene zurückhaltende Benehmen passt tatsächlich auf mich, aber anscheinend eben auch auf viele andere.“ – Jedenfalls ist Gomringer zeitlebens politisch und ideologisch neutral geblieben und hat auch seine literarischen Texte von entsprechender Befrachtung freigehalten: Stets war ihm die „gute Form“ wichtiger als jede ausserkünstlerische Parteinahme.
*
Die „gute Form“ hatte Gomringer schon in seinen lyrischen Anfängen gepflegt. Damals verfertigte er, ermutigt durch Hermann Hesse, seine ersten Sonette, deren rigide Struktur sein handwerkliches Geschick offenbar herausforderte. Sowohl Hesse wie auch das Sonett waren für die spätere „konkrete“ Dichtung obsolete Referenzen. Doch in seinem 80. Lebensjahrzehnt kam Gomringer noch einmal darauf zurück, glaubte das Sonett „neu“ erfinden zu können und startete, davon ausgehend, ein „neues“ (sein letztes) literarisches „Experiment“. Ab 2008 verfasste er jedenfalls eine Vielzahl von regulären Sonetten aus oftmals privatem Anlass, grösstenteils mit beschaulichen Motiven oder gedanklichen Exkursen, die allem zuwiderlaufen, was er einst als Wortführer der „Konkreten“ propagiert hatte.
Dennoch versuchte er das Sonett als eine angebliche Urform „konkreter“ Dichtung zu rechtfertigen mit der Feststellung: „es erfordert konzentriertes ‘berichten’ von inneren und äusseren fakten in einer vorgegebenen struktur, deren durchschaubarkeit ich akzeptiere …“ – Dazu das hochgemute Bekenntnis: „Ich könnte jeden Tag ein Sonett schreiben.“ Und das liest sich dann beispielsweise so:
resort
wir gäste ausgewählt aus deutscher ferne
geniessen gärten teiche feine rasen
der rosen düfte in genauen vasen
des kellers ruhm und einer küche sterne
es ist die schönste möglicher oasen
das bildnis eines landes dichtem kerne
hier ist und isst man immer wieder gerne
bleibt ungestört von etwa schlechten phrasen
scheint es nicht sinn zu sein auf solcher reise
am teich zu weilen auf gebogner brücke
wo alte karpfen ziehen ihre kreise
sie schnappen offnen munds nah gutem stücke
empfangen spende und entschwinden leise
sie sind im schweigen die berühmte lücke
Solche Verse könnten auch auf der Speisekarte eines Gourmet-Restaurants stehen oder auf der Einladung zu einem Workshop für traditionelle Reimkunst, doch Gomringer biegt sie selbstgewiss auf die „konkrete“ Dichtung zurück, indem er mit der Schlusszeile direkt auf „die berühmte lücke“ anspielt, die er einst in einem seiner bekanntesten Gedichte unter dem Titel „schweigen“ (1960) visualisiert hatte:
Insgesamt hat Eugen Gomringer vier Bände mit Sonetten vorgelegt, zuletzt eine Sammlung von weit über hundert Texten („sämtliche sonette“, 2019) – jeder Vers, jeder Reim handwerklich sauber gearbeitet, alles in erwartbarer, höchst konventioneller Bildsprache und Gedankenführung, ganz ohne die einstige Spiel- und Risikofreude, die doch immer wieder (wohl auch für ihn selbst) überraschende Wortkonstellationen hervorgebracht hatte.
Entgegen den Beteuerungen des Autors ist diese altmeisterlich bewerkstelligte lyrische Form eher mit seinen dichterischen Anfängen als mit seinen späteren „konkreten“ Texten zu vergleichen, sehr wohl jedoch erinnert sie an die klassizistisch gefügten und gereimten Sonette eines Conrad Ferdinand Meyer oder Gottfried Keller. Ob Gomringer vielleicht doch als ein „typisch“ schweizerischer Dichter gelten kann? Und darüber hinaus als ein authentischer „Schwiizer“?