
Ganz bei mir bleiben. In meinen Texten, in meinem Vortrag. Ich bin Lyriker, ich schreibe Gedichte und keine Romane. Das heißt, ich muss mir nicht täglich eine Seite Prosa rausquälen (wie ich es auch schon getan habe), sondern darf sprunghaft und phlegmatisch sein, einfach dahinleben und mir eine gewisse Zeitoase zur schreibenden Besinnung einräumen.
Dies ist meinen momentanen Lebensumständen geschuldet. Ich bin Nachtarbeiter geworden. Noch vor eineinhalb Jahrzehnten ging ich vom Bett aus direkt an den Schreibtisch und erledigte mein Schreibwerk, noch saumselig aus der Nacht heraus, frisch und ungefiltert konnte ich den erwachenden Gedanken nachgehen, ihnen hinterherschreiben, sie zu fassen kriegen und en passant auch größere Prosastrecken bewältigen.
Das ist vorbei. Wir haben zwei Kinder, ein bis an die Knochen gehender, hochfrequenter Ton piept um 6:30 Uhr, dann heißt es, aufstehen, anziehen, Weckdienste an den Kindern vollziehen, aufdecken, Brote schmieren, Minimal-Konversationen am Laufen halten bzw. ertragen, Zeitung lesen – und wenn die Kinder in die Schule radeln, sind die den Geist erweckenden Akkus bereits halbleer.
Also erledige ich am Morgen die Schreibarbeiten, in denen der Hauch der Inspiration kleingeschrieben ist: Mails, Briefe, Überarbeitungen, Zugfahrten buchen, Grübeleien über anstehende Grundsätzlichkeiten neuer Projekte, Sortierarbeiten, Recherchen, Telefonate, Aufsätze, Lektüren.
Der Tag nimmt seinen Lauf. Mittags kochen, essen, die Kinder kommen aus der Schule. Nachmittags bin ich ganz normaler Familienvater, das heißt: schön auf dem flauschigen Wohnzimmerteppich rumkugeln, aus Versehen einschlafen, Musik hören, Spiegel online lesen, Haus- und Gartenarbeiten erledigen, H.C. Artmann lesen, Stadtfahrten angehen, mit dem Sohn auf den Fußballplatz, mit der Tochter auf den Pferdehof (sie reitet ein Araber-Pferd), mit der Frau spaziere ich frühabends an der Kieler Förde entlang (wir erzählen uns unseren Tag – eine wunderbare, beziehungsstabilisierende Gewohnheit), im Sommer bin ich viel am Strand, nach der Tagesschau wird vielleicht noch etwas fern gesehen, Murakami oder Knausgård gelesen, alles ganz normal, wie es jeder kennt. Ich habe auch kein Problem damit, sondern halte es wie Tonio Kröger bei Thomas Mann: „Man ist als Künstler innerlich Abenteurer genug. Äußerlich soll man sich gut anziehen, zum Teufel, und sich benehmen wie ein anständiger Mensch“.
Zu dieser Einsicht zu kommen, hat mich viele Jahre gekostet: Jahre des Leichtsinns, des trotzigen Aufgehens in einem juvenilen Loser-Feeling, Jahre der inspirativen Erweckung samt arroganter Zurschaustellung einer freilich noch nicht ausgereiften Künstlernatur, Jahrzehnte des Coolseins und der unangemessenen Überheblichkeit. Für mich ist das alles Geschichte. Mein Alltag, der meine drei Glücksfaktoren bedingt – erstens frei über die eigene Zeit verfügen, zweitens etwas tun, was man gerne tut, drittens so viel Zeit wie möglich mit denen verbringen, die einem am meisten am Herzen liegen – hat mich Demut gelehrt.
Allerdings bin ich in meinem Alltag 24 Stunden online mit meinem erweiterten Bewusstseinsstrom. Kommt mir etwas Sonderliches in die Quere, schreibe ich es in meinen Notizblock. Mein Credo seit vielen Jahren: Ein Tag, von dem nichts übrig bleibt, der ist nichts wert – oder als Variante: Ein Tag, von dem nichts übrig bleibt, der ist verloren für immer.
Und ich bin ein vergesslicher Mensch. Also bewege ich mich mit offenen Sinnen und sammle via Notiz, was ich sehe, was ich höre, was ich denke. Mein Sohn erzählt etwas von Arschhaaren vom Elefanten, ich schreibe es auf. Meine Tochter zeigt mir auf ihrem Handy ein Foto, auf dem sie aus ihren langen Haaren einen Kranz zu einem Nest geflochten hat, damit sie ihr schwarzes Lieblingshuhn hineinsetzen kann. Ich schreibe es auf. Und überlege später, als ich das Foto noch einmal betrachte: Ist der Kopf ein Nest, der das Huhn behütet – oder hat das Huhn den Kopf ausgebrütet? Ich sitze am Strand und die Möwe mit dem Totenkopf fliegt vorbei, ich schreibe es auf.
Manchmal bleibt der Notizblock leer. Dann wundere ich mich, warum ich so unausgeglichen bin. Vielleicht bin ich auch nur ungeduldig, denn eigentlich weiß ich, dass die Zeit literarischer Schaffensdurststrecken eine bald kommende Zeit literarischer Fruchtbarkeit einläutet. Nichts ist umsonst, so eins meiner Hilfskonstrukte zur Selbstüberlistung, auch nicht die Zeit des Müßiggangs, des vermeidlichen Müßiggangs müsste man korrekterweise sagen, oder noch besser, man schaltet den Müßiggang mit einer Zeit der geistigen Rekonvaleszenz gleich, welche erst den nächsten Produktivitätsschub bedingt. Wenn es mal nicht so läuft und man bloß einmal mehr dahinströmt, ist Gelassenheit angesagt, gelingt aber nicht immer. Jeder produktive Mensch kennt das.
Der Tag bekommt einen fruchtbringenden Dreh, wenn die Familienmitglieder schlafen gehen. Wenn die Kinder schlafen, wenn meine Frau schläft, wenn kein Festnetz mehr klingelt, wenn kein Handy mehr klingelt, wenn ich keine SMS mehr bekomme, keine Whatsapp-Nachricht mehr bekomme, wenn keine E-Mails mehr kommen, dann bin ich an meinem Schreibtisch hellwach – und es wird ganz still in meinem Kopf. Da ist es meist schon Mitternacht. Nun habe ich zwei, drei Stunden, in denen ich entrücke und ganz bei und in mir sein darf. Ein Zustand der Entgrenzung. Ich schrieb über die Bedeutung dieses Moments ein „selbstportrait als nachtarbeiter“:
sitze am schreibtisch
trinke bier bedien die tastatur
schaue auf die uhr
nulluhrnull im monitor
erneutes nichts so beginnt der tag
des jüngsten gedichts
Erstes Paradoxon: Auflösungserscheinungen
Der Moment der nächtlich-produktiven Selbstvergessenheit. Kinder helfen einem im Leben, sich aus dem Würgegriff der Egozentrik zu befreien, einfach, indem man merkt, wie viel Liebe zu geben man imstande ist und dass man bereit ist, das andere, aus einem entstandene Leben als das Wertvollere, Wichtigere zu begreifen, kurz, dass man dabei ist, sich im Weltgebaren aufzulösen. Dieser Umstand setzt zweierlei in Gang: Zum einen eine mit nichts zu vergleichende Befriedigung, Teil am Lauf der Welt zu sein und Anteil daran zu haben, einem biologischen Programm zu folgen. Andererseits eine Trotzreaktion: Keine Ich-Auflösung bitte! Und wenn doch, so möge im Rahmen dieser Auflösung mein Kern erst recht zu leuchten beginnen!
Zweites Paradoxon: Von mir lernen, indem ich mich vergesse
In der nächtlichen Entrückungsphase spiegelt sich ein seltsam befriedigender Zustand wider: einerseits bin ich dabei, mich vollends zu verlieren, aufzugehen in meinem In-mir-um-mich-Spiel, andererseits bin ich zu keinem Zeitpunkt meines Lebens näher dran, mich zu finden (und zwar anders als in einem gut angezogenen Gegenüber in der Schaufensterscheibe).
Sich widersprechen ist immer auch Teil der Selbstbefragung, der Nach- und Neujustierung.
Das regellose Dichtwerk widerspricht sich ohnehin ständig, und ermöglicht so erst die Bewegung. Ich denke an John Cage, der sagte: Ich habe nichts zu sagen/ und ich sage es/ und das ist Poesie/ wie ich sie brauche.
Doch zurück an den mitternächtlichen Schreibtisch: Niemand will etwas von mir. Zeit wird wieder spürbar, ummantelt mich und ich? – muss erst einmal sehen, wie ich in ihr aufzugehen imstande bin. Dann mache ich mehr oder weniger lustlos Sachen, die mich den Alltag abwerfen lassen (im Internet nach diesem und jener schauen) oder meinen Blick fokussieren, z. B. indem ich Gedichte sehr flüchtig und schweifend lese, auf der Jagd nach mich anregenden Verlesern: Hut statt Haut, verseuchen statt versuchen, Zerfall statt Zufall; vielleicht dauert es eine Stunde, bis Denkbewegung und (Un-)Zeitgefühl im Einklang sind, ich in mir angekommen bin und mich jenseits aller Ergebnisorientierung an einen Zustand der Schöpfung anzubinden verstehe. Der innere Blick kanalisiert sich, wird zum Tunnelblick, auf den Bildschirm gerichtet; zugleich erweitern die Gedanken ihre Kreise, flüchten aus meinen engen Denkmarkierungen und dringen dabei, ein weiteres Paradox des Schreibens, tiefer in mich ein. Wo liegen die Grenzen, die meine Vernunft mir aufzwingen will?
Wenn es zu laufen beginnt, sich also Text ergibt, ist es eine beinahe spirituelle Erfahrung, wenn dann noch ein Gärungsgetränk und ein leichtes Nervengift dazu kommen, ist es eine Art Rock’n’Roll am Schreibtisch. Ich denke an die Amazonas-Indianer, die Lévi-Strauss in den 30er-Jahren des vorigen Jahrhunderts qua teilnehmender Beobachtung begleitet hat: Nachts singen und sich berauschen – und erst zum Sonnenaufgang schlafen legen; dann bis mittags schlafen – was ja auch Sinn macht: der Dunkelheit, dem Verborgenen, den Fraßfeinden mit Vitalität zu trotzen und zu ruhen, wenn das Licht es den Sinnen – der Mensch ist ein Augenmensch – einfacher zu machen versteht.
Wenn es läuft, sitze ich oftmals an mehreren Texten gleichzeitig. Das Schreiben am Laptop ist dabei unabdingbar. Ständig muss der Text wieder umgeschrieben werden, Einschübe kommen hinein und heraus, mit einem Mal habe ich lose Enden zu fassen, verliere mich in Formulierungsvarianten, plötzlich nötigen Recherchen, durchforste Reimlexika auf der Jagd nach dem passenden Wort, ergehe mich in Wortfeldanalysen, um mich einem Phänomen anzunähern, lese mir laut etwas Geschriebenes vor – bin das Medium meiner selbst.
Dabei verfolge ich kein Programm. Ich versuche, im Leben so gut wie möglich zu funktionieren, Kompromisse und Konventionen einzugehen, und das ist völlig okay für mich; bitte, so wenig Widerstände wie möglich, denn ich brauche meine Kraft. Allerdings muss ich Konventionen nicht auch noch in der Kunst haben. Hier ist die Rücksichtslosigkeit mein Freund und Partner. Und also ist es mein lyrisches Programm, keines zu haben.
Mir geht es in der Poesie ums Zulassen, um den unbewussten Entgrenzungszustand, den dunklen Funkenschlag, darum, den Möglichkeiten, die sich auftun, Raum zuzugestehen.
Das heißt gereimt und ungereimt, flach und tief, bunt und schwarzweiß, hässlich und schön, heiter und ernst, heiß und kalt, ein Wandeln am Rande des Abgrunds, ein Schweben in Sphären des Hans-Guck-in-die-Luft, gern schreibe ich auch Gedichte für Kinder oder verfalle der Visualität der Schrift in konzeptuell angelegten Texten, etwa für den Kunstraum. Auch das kann eine poetische Selbsterfahrung sein: sich vor einem kreisförmig gesetzten visuellen Gedicht, welches in fünf Meter Durchmesser via Schablone an die Museumswand gestenzelt wurde, ganz klein zu fühlen. Zusammenzuschrumpfen vor einem Text, der einem zudem inhaltlich noch die Endlichkeit aufzeigt. Hier bekommt das Gedicht jäh eine ganz andere Kraft als im Dunkel eines meist zugeschlagenen Buchs.
Wenn es so etwas wie einen konzeptuellen Dreh gibt, der meine Schreibarbeit am Laufen hält, so muss man schon weit zurücktreten, um ihn überhaupt auszumachen. Dann sieht man zwei Ansätze: Zum einen, das Kleine groß machen (also nicht als „der Versteher“ angebliche Wahrheiten für Follower in Würfelform zurechtzuminimieren) – sondern genau hinzusehen und die vermeidlichen Belanglosigkeiten als Sensationen zu nehmen) – zum anderen: Dinge zusammenzubringen, die nicht zusammengehören. Prinzip Collage also, oder: Ausgleich durch Unordnung, um einem System näher zu kommen, das wir nicht verstehen können.
Der Tag danach
Wie sehr ich beim Schreiben als Medium meiner selbst auch neben mir stehe, merke ich, wenn ich am nächsten Morgen aufwache und nicht mehr weiß, wo ich in der Nacht zuvor gewesen bin. An welche Ufer habe ich mich, wurde ich, wurde ich von mir hingespült? Welche mentalen Schlingen und Winkelzüge habe ich vollzogen? Im „Rückerobern“ des frisch Geschriebenen, im Hinterhergehen, ja Hintergehen von Stimmungen und Gefühlen liegt ein erstes Moment der Selbsterkenntnis.
Indem ich einen aus mir entstandenen Texte lese, begebe ich mich, diesmal mit einem reflektierteren Sensorium als im Moment des Schreibens, auf die Spuren meiner selbst, meiner aufgelesenen Wahrnehmung. Ich bin auf der Suche nach dem, was mich ausmacht, was mich umtreibt, darf Goldschürfer meiner selbst sein: Bürste ich genug gegen den Strich? Erzeuge ich genug Reibung, um zu merken, dass ich lebe? Übertragen sich Überschwang und Lebenslust? Bekomme ich im Dunkeln etwas angeleuchtet? Ist ausreichend Undurchdachtes im Text geblieben?
Wenn mir ein Text nach einer gewissen Liegelänge gelungen scheint, kann ich ihn rausgeben zur Veröffentlichung. Wenn er mir misslungen scheint, packe ich ihn in einen Ordner mit dem Titel „Halbfertigkeiten“ – dessen Dateien ich, wenn mir nichts Besseres einfällt, immer mal wieder durchkämme. So kann ich auf die Frage: Wie lange dauert ein Gedicht? nur antworten: Zwischen zehn Sekunden und zehn Jahren ist alles möglich. Zehn Sekunden: der mir vielleicht viermal im Jahr widerfahrende Streich, der sofort gelingt. Zehn Jahre: ein vielleicht guter Anfang eines Textes, den ich vor einer Dekade anging, kann nun, mit dem taufrischen Blick fortgeschrittener Erfahrung und Veränderung seinen entsprechenden Fortgang zur Fertigstellung erfahren.
Jedenfalls finde ich über die Reflexion des Geschriebenen (nennen wir es ruhig Überarbeitung), über das „es schreibt“ zu einem „ich schreibe“ zurück. Und ich trage die Selbsterkenntnis, die ich daraus gewinne, für alle weiteren Texte in und mit mir.
Das Verrückte beim Schreiben (etwa im Gegensatz zur Bildenden Kunst) ist ja, dass ich etwas von mir gebe, das ich bei mir behalten kann. Die Rede ist von Momenten, in denen der Text zur Performance kommt, also von Lesungen oder Veröffentlichungen. Der Text bleibt mir, und wenn ich ihn brauche, ist er da. Und so ist das Schreiben ein Instrument der doppelten Selbsterkenntnis: einmal über die Reflexion des Geschriebenen, einmal über die Reaktion aufs Geschriebene.
Nach dieser doppelten Selbsterkenntnis bin ich süchtig und für diese doppelte Selbsterkenntnis bin ich dankbar. Sie ermöglicht mir, meine Konturen, meine Tiefen, Kanten und Rundungen zu erkennen. Sie ist mir Seelenhygiene.
Die Summe meiner Texte ist darüber hinaus mein emanzipiertes Tagebuch, was bedeutet, dass die mir wichtigen Wegmarken meines Lebens einen Platz zugewiesen bekommen und ich über meinen Tod hinaus lesbar bleibe. Was vielleicht nicht für viele wichtig ist, aber vielleicht doch für die, denen ich wichtig bin. Kurz: Etwas, das mich ausmacht, ist zum Hinterlassen da. Eine Spur. Poesie ist für mich, die Spur der Einmaligkeit zu setzen, die meine Existenz ausmacht. Das mag nicht viel sein. Aber vielleicht ist für eine überschaubare Zeit eine Spur mehr als keine Spur. Als Schöpfer, als Schöpfer von Text fühle ich mich so dem Rausch einer fiktiven Ewigkeit angebunden. Möglicherweise ist das Sich-berauschen an einer fiktiven Ewigkeit nicht mehr als eine (mir nötig scheinende) Behelfskonstruktion zur Selbstüberlistung, um den Gedanken an die Endlichkeit all dessen, was mir etwas bedeutet, ertragen zu können. Schreiben als Seelenbalsam.
Zudem genieße ich, Teil eines großen Gesprächs zu sein. Poesie ist ja der weltweite und zeitübergreifende Code der Feinsinnigen. Indem ich mich über Lektüre mit dem gemein mache, was ein inzwischen Verstorbener oder fernab auf diesem Planeten lebender Mensch in einem Gedicht hinterlassen hat, indem mich sein oder ihr Gedicht befeuert, mir neue Denk- und Dachkraft gibt, indem mich ein Gedicht zu einem anderen Gedicht animiert, bin ich Teil des großen Gesprächs. Umkehrschluss: anderen bin ich mit meinen Gedichten Funkenschlag über Zeit und Raum hinweg. Mir ist das wie ein stiller Triumph: denn mein Denken reicht zum Durchdringen größerer Zusammenhänge nicht aus; doch schreibe ich weniger, um die Sprache der Erklärung zu bedienen, sondern vielmehr, um mich mit der Sprache der Poesie an der Verklärung zu beteiligen, quer durch alle Wahrscheinlichkeiten der Sterbetafeln hindurch etwas in die Welt hinein zu zaubern, zu verschleiern und so dem Wesen des Tatsächlichen im Angesicht wahrhafter zu begegnen.
Mäandern
Das Abenteuer des grenzenlosen Mäanderns, es ist wirklich eins, und so nehme ich die Herausforderung, das Scheitern als Chance, auch als eine intellektuelle Grenzerfahrung an, ich wandel am Abgrund, schaue und steige hinein, dahin gehen, wo es weh tut, die Lieben, die Eltern, die Kinder, der Tod, das Naive an allem, die Dinge einfach mal so nehmen, wie sie sind, und nichts hinzufügen, sie stehen lassen, bedenkt sehen und so neu und wieder und vielleicht einmal im richtigen Licht sehen, die Welt als Wunder, die Welt der Kleinigkeiten als Wunder feiern, ich als du, du als ich, wir tauschen unsere Häute, gehen in uns, durchdringen uns, und da erst spüre ich, was du mit mir machst, was das mit mir macht, schon bin ich mir Ablassventil, Tränenkrüglein, gehe im Augenblick auf, eine zen-hafte Erfahrung, jedenfalls reicht der Zustand aus, mir das als eine solche vorzustellen, und schon gehe ich in der Kunst auf, die mich berührt, ich habe mehr Einfälle, während ich mich in Museen aufhalte, als während ich mich in der Natur aufhalte, Max Ernst, die Jungfrau züchtigt das Jesuskind, Noldes Wolken im gelben Himmel, die aussehen wie faulende Auberginen, die Weltuntergangsstimmung bei Radziwill, das lange Schwert von Barlachs 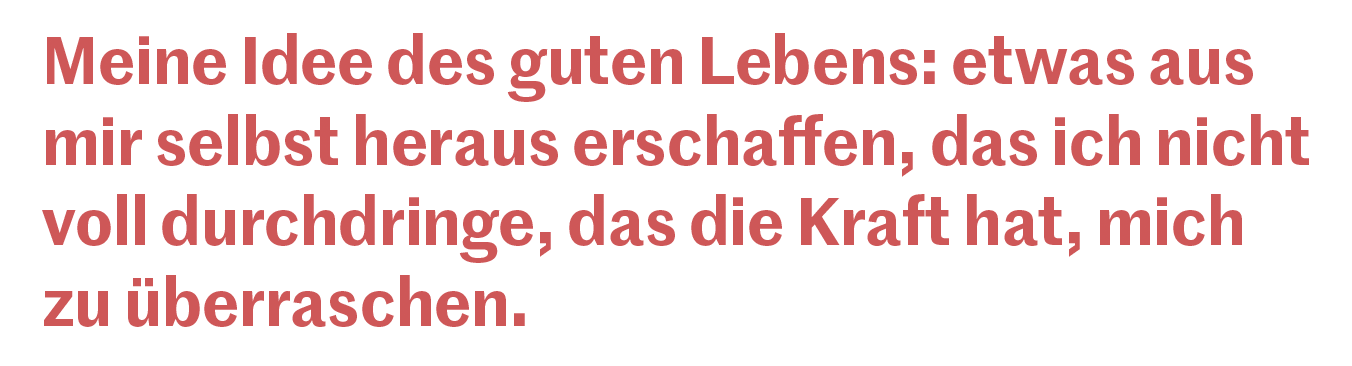 Geistkämpfer, van Goghs Sonnenblumen, da, Emily Dickinson erwartet nach einem langen Winter die Bienen zurück oder Lemmy Kilmister hilft mir, meinem Drang nach Zerstörung nachzugehen, ich gehe mit der Kettensäge durch Teletubbi-Land, spiegel mich, googel meinen Namen, um zu sehen, dass es mich gibt, zerstöre mein Spiegelbild, ergehe mich in Erinnerungen, schweife ab, lasse es laufen, erzähle in Gedichtform von mir und meinem Leben, einfach so, 1:1, Magic Moments, entscheidende Begegnungen, gehe in Wörtern auf, wie durchschraubbar ich bin, Mutter, lese in
Geistkämpfer, van Goghs Sonnenblumen, da, Emily Dickinson erwartet nach einem langen Winter die Bienen zurück oder Lemmy Kilmister hilft mir, meinem Drang nach Zerstörung nachzugehen, ich gehe mit der Kettensäge durch Teletubbi-Land, spiegel mich, googel meinen Namen, um zu sehen, dass es mich gibt, zerstöre mein Spiegelbild, ergehe mich in Erinnerungen, schweife ab, lasse es laufen, erzähle in Gedichtform von mir und meinem Leben, einfach so, 1:1, Magic Moments, entscheidende Begegnungen, gehe in Wörtern auf, wie durchschraubbar ich bin, Mutter, lese in
Dieser Beitrag ist nur für Abonnenten zugänglich. Bitte melden Sie sich in Ihrem Konto an, oder wählen Sie eines der drei unten stehenden Abos, um sofort weiterzulesen.
Das erfolgreichste, weil intellektuell beweglichste Literaturblatt unserer Tage*
– für den Preis von einem Espresso im Monat.
Förder-Abo
€ 9,00 / Monat
(Mindestlaufzeit: 12 Monate)
- Zugang zu allen Online-Beiträgen
- Printausgabe (4 Hefte / Jahr)
- E-Paper-Ausgabe (4 Hefte / Jahr)
- 300+ Online-Beiträge / Jahr
- Online-Leseproben und Vorabdrucke
- Zugang zu E-Paper-Ausgaben im Archiv
- Zugang zu ca. 2000 Beiträgen im Archiv
- Tägliche Presseschau
- Newsletter
- Novitäten-Telegramm
- Preis-Telegramm
- Ausschreibungen
- Ausgewählte VOLLTEXT E-Books
- Ausgewählte VOLLTEXT Specials
Digital
€ 2,00 / Monat
(Mindestlaufzeit: 12 Monate)
- Zugang zu allen Online-Beiträgen
- E-Paper-Ausgabe (4 Hefte / Jahr)
- 300+ Online-Beiträge / Jahr
- Online-Leseproben und Vorabdrucke
- Zugang zu E-Paper-Ausgaben im Archiv
- Zugang zu ca. 2000 Beiträgen im Archiv
- Tägliche Presseschau
- Newsletter
- Novitäten-Telegramm
- Preis-Telegramm
- Ausschreibungen
Print & Digital
€ 3,00 / Monat
(Mindestlaufzeit: 12 Monate)
- Zugang zu allen Online-Beiträgen
- Printausgabe (4 Hefte / Jahr)
- E-Paper-Ausgabe (4 Hefte / Jahr)
- 300+ Online-Beiträge / Jahr
- Online-Leseproben und Vorabdrucke
- Zugang zu E-Paper-Ausgaben im Archiv
- Zugang zu ca. 2000 Beiträgen im Archiv
- Tägliche Presseschau
- Newsletter
- Novitäten-Telegramm
- Preis-Telegramm
- Ausschreibungen
* Saarländischer Rundfunk
FAQ
Wie kann ich ein VOLLTEXT-Abonnement verschenken?
Sie können alle VOLLTEXT-Abonnements befristet oder unbefristet verschenken. Die Mindestlaufzeit beträgt ein Jahr. Danach kann das Abonnement auslaufen oder wahlweise durch die Schenkenden oder die Beschenkten verlängert werden.
–> Bestellinformationen
Was sind E-Paper-Ausgaben?
E-Paper-Ausgaben entsprechen 1:1 der gedruckten Zeitschrift. Abonnenten erhalten nicht nur Zugriff auf die jeweils aktuelle Ausgabe, sondern auch auf ältere Hefte im Archiv (gegenwärtig alle Ausgaben seit 2016).
Gibt es Kündigungsfristen?
Nein, Sie können das Abonnement jederzeit formlos per E-Mail oder Post kündigen.
Ich bin bereits Abonnent der Printausgabe und möchte Zugang zu den Online-Beiträgen, wie komme ich dazu?
Wenn Sie bereits über ein Online-Konto auf Volltext.net verfügen, können Sie mit Ihrem bisherigen Passwort auf die Beiträge hinter der Paywall zugreifen.
Ich kann die heruntergeladenen E-Paper-Ausgaben nicht öffnen.
Die E-Paper-Ausgaben sind mit einem Passwort geschützt. Informationen zum Passwortschutz finden Sie nach der Anmeldung auf der Startseite Ihres Online-Kontos.
Wo finde ich mein Online-Konto?
Am oberen, rechten Rand des Bildschirms finden Sie einen Link „Mein Konto“, über den Sie sich einloggen können.
