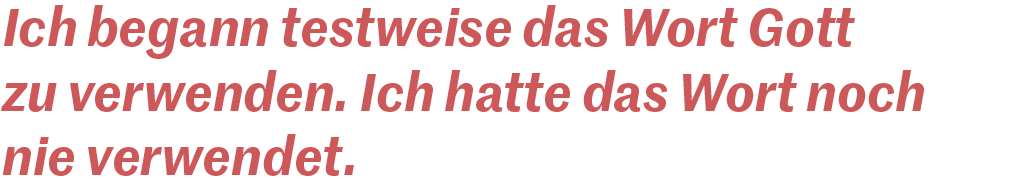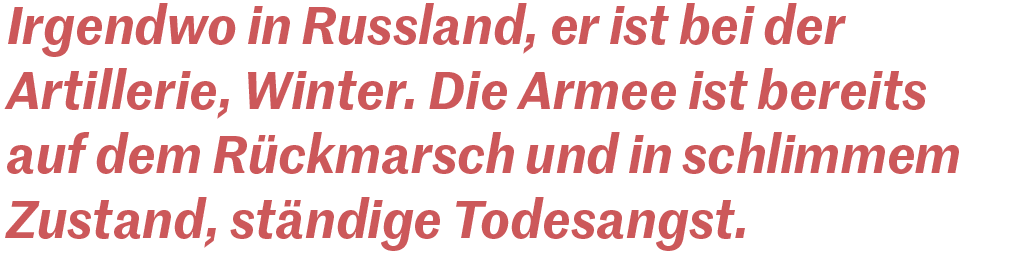Foto: PhotographerFFM
Ich gerate öfter in Gespräche mit Atheisten oder solchen, die sich so bezeichnen. Ich bin hier versucht, eine geschlechterneutrale Formulierung zu verwenden, eigentlich sollte ich sagen, mit Atheistinnen oder Atheisten. Aber wenn ich in mich gehe und meine letzten dreieinhalb Lebensjahrzehnte durchmustere, dann handelte es sich tatsächlich ausschließlich immer um Männer, die forciert atheistische Gespräche führen wollten und von einem Materialismus her argumentierten, der offenbar für sie so prägend war wie die Tatsache, dass sie zwei Hände und zwei Füße hatten.
Sie kennen alle diese Gespräche, bei denen man als glaubender Mensch immer anscheinend in eine Verteidigungshaltung gerät, weil das Gesprächsgegenüber erstens gern mal erklärt hätte, wie denn ein Mensch auf so etwas Seltsames verfallen kann wie auf einen Glauben an einen Gott, und weil zweitens diese Gesprächspartner dann auch gern sofort diesen Gott manifest und gleichsam physisch prägnant gezeigt haben wollen, als müsste ich nur einen Stein vom Boden aufheben und siehe da, dahinter wird er sichtbar, Gott, den mein Gegenüber ein Leben lang nicht gesehen hat oder nicht zu sehen glaubte, der zumindest seine Begriffe so verwendete und ordnete, als sei Gott natürlich eine bloße Konstruktion, und zwar eine so banale, als würden wir, die von Gott Redenden, glauben, Gott befinde sich hinter dem nächsten Stein.
Ich bin immer wieder erstaunt, wie sich mitunter ein materialistischer Kopf einen Gottesglauben vorstellt, immer wieder erstaunt, für wie banal er ihn halten kann, immer wieder erstaunt, dass er mich herausfordern will, dass er mich seinen Argumentationsmustern unterwerfen will, und am Ende habe ich immer das mulmige Gefühl, einen Menschen vor mir zu haben, der sich doch in einer gewissen Banalität erschöpft. Solche Gespräche haben schnell gern einen Horizont von Rechthabenwollen, Konkurrenz, von Herablassung, nur wenige sind ehrlich erstaunt und wollen mir tatsächlich in meinen Glaubensgedanken näherkommen. Andere prüfen ihre wenigen Begriffe an mir ab, halten mich im Grund für einen Spinner, und das war es.
Gott, ein handliches Thema
Ein weiteres fällt mir an diesen Gesprächen auf, und zwar umso mehr, je länger ich lebe. Nämlich frage ich mich immer wieder, warum das Thema Glaube oder Gott für sie ein so kleines, so handliches Thema ist, für mich aber so riesig und differenziert, riesiger und differenzierter als Literatur, als eine Spieltechnik auf einem Instrument, so riesig und differenziert wie Philosophie. Mit der Beschäftigung mit Philosophie haben sie keine Probleme, das finden sie oftmals vielleicht nur etwas zu hoch für sich, aber sie hegen sogar grundlegend eine Bewunderung für Philosophen. Hören sie jemanden mit guter Beherrschung ein Instrument spielen, fragen sie auch nicht: Was soll denn das, warum macht der oder die das? Aber da Glaube und der tägliche gedankliche Umgang damit (oder Nichtumgang, das ist ja auch ein großer Teil von Glaube) ihnen fremd ist, haben sie eine sehr vorschnelle Meinung über mich, aus der in erster Linie eines spricht, nämlich völliges Desinteresse.
Ich spreche ihnen überhaupt nicht ab, dass es ein Desinteresse aus sehr guten Gründen sein könnte. Aber es ändert nichts an der Tatsache dieses Desinteresses. Und Sachen, für die man sich nicht interessiert, kann man eben schnell für lächerlich halten. Denken Sie an ostfriesisches Boßeln. Wir lachen ja auch über die Ostfriesen, wenn sie tagelang ihre Straßen und Deiche entlang Kugeln werfen. Würden wir selbst boßeln, würden wir darüber niemals lachen.
Atheisten und Materialisten
Meine Damen und Herren, ich muss mir hier selbst ins Wort fallen, weil ich das nicht so einseitig stehenlassen kann. Ich habe eben in einer zu abwertenden Weise über gewisse Atheisten und Materialisten gesprochen und so getan, als sei jeder, der mit dem Wort Gott oder mit Glauben oder Glaubensvollzug nichts anfangen kann, bloß nur desinteressiert oder einfach gestrickt.
Ich muss hier in verschiedene Gruppen unterscheiden. Die einen haben wirklich nichts damit zu tun, das sind meist Leute, die gleich alt wie ich sind. Die finden oft nur schräg, das Wort Gott überhaupt zu verwenden. Aber nehmen wir Leute, die nur fünfzehn, zwanzig Jahre früher geboren sind, oder die zwar so alt sind wie ich, aber südlicher, etwa in Bayern, geboren sind (ich bin Hesse), und schon sieht die Lage etwas anders aus.
Diese nämlich haben oft in ihrer Schule, ihrer Erziehung Kontakt zu kirchlichen Institutionen gehabt, waren in die Kirche eingebunden, sei es als Messdiener, sei es, dass sie in einem kirchlichen Internat waren, und solche Leute finden so etwas wie Glauben oft eher seltsam aufgrund ihrer eigenen biografischen Erlebnisse mit Glauben. Im Groben gesagt: Gewalt, Missbrauch, Ohrfeigen, Strafen, Psychoterror. Oder mindestens unendliche Langeweile, besoffene Priester, seltsame Anwandlungen, Doppelmoral. Neulich erzählte mir ein Frankfurter, 63 Jahre alt – und Sie wissen, 63 Jahre ist heute nicht mehr so uralt wie früher, er spielt Fußball, ist ein ziemlicher Musikfreak, ich sehe ihn öfter beim Apfelwein – neulich also erzählte er mir von seiner ersten Beichte als Kind. Diese erste Beichte führte zu keinen größeren Problemen. Das Groteske für ihn war allerdings, dass er bei der Beichte, also seiner ersten, zehn Sünden angeben sollte, das hatte ihm der Pfarrer vorher, und nicht nur ihm, sondern allen seinen Klassengenossen, eingeschworen.
Also, kurz gesagt, mein Bekannter litt nicht allzu sonderlich darunter, diese zehn Sünden zu erfinden, bei empfindlicheren Gemütern könnten sich eine Mann und eine Frau natürlich vorstellen, dass so ein Seelenexperiment schlimme und sehr schmerzhafte und nachhaltige Konsequenzen haben kann. Aber mein Bekannter fand es vor allem nur grotesk. Er fragte mich als Ehemann einer katholischen Professorin, was denn an diesem Glauben dran sein kann, wenn man so einen Schwachsinn ableisten muss. Nota bene: Er bekam seine zehn Sünden natürlich bei der Beichte nicht zusammen, und auch das endete völlig unproblematisch. Aber durch solche Details des programmatischen Unsinns sammelten sich in ihm damals, in seinen Prägungsjahren, vor allem immer eins, nämlich Gegenargumente gegen den Glauben, oder besser gesagt, es sammelten sich in ihm zahllose Warum-Fragen. Denn zahllose Dinge kamen ihm unsinnig vor, und ich würde sagen, alles, was ihm unsinnig vorkam, kam ihm in erster Linie deshalb so vor, weil es in actu tatsächlich völliger Unsinn war. Er sah die katholische Kirche insgesamt als groteske Veranstaltung und fragt sich bis heute, im Übrigen in völlig ehrenwerter und aufrichtiger Weise, wie man bei einer solchen Zirkusveranstaltung mitmachen kann.
Menschenwerk
Theologisch kommt er der ganzen Sache natürlich nicht näher. Es würde ihm auch schwer zu vermitteln sein, dass es auf alles das, was er erzählt, im theologischen Sinn überhaupt nicht ankommt, sondern dass dies alles, wie jede Institution, Menschenwerk ist, genauso richtig oder falsch oder gut oder pervers wie alles Übrige auch, vom Sportverein bis hin zur universitären Hochschule. Aber wenn ich ihm das sagte, würde er noch mehr den Kopf schütteln und entgegnen, dann spinnen ja wirklich alle, die damit zu tun haben.
Ich darf auch noch anmerken, dass dieser Bekannte etwa unsere Apfelweinwirtschaft, in der wir gemeinsam verkehren, für eine wesentlich sinnvollere und unverstelltere und unverlogenere Angelegenheit hält als die Kirche in seiner Jugend, und dass er sich in dieser Wirtschaft fraglos viel lieber aufhält, einfach weil eine Apfelweinwirtschaft ihm gegenüber nicht einen Erlösungshorizont behauptet, den das Menschenpersonal darin gar nicht einlösen könnte. Hier ist der Stein, hinter dem etwas verborgen sein könnte, sozusagen schon immer gehoben, und deshalb geht er in die Wirtschaft.
Aber kommen wir auch hier bitte auf die andere Seite. Kommen wir zu den Glaubenden, den Christen, hier eine erste Annäherung, und zwar an eine größere Gruppe der Glaubenden. Mir ist aufgefallen, dass zu den Angriffsgesprächen, die gewisse männliche Atheisten gern führen, ein Äquivalent auf der anderen Seite existiert, nämlich die völlige Abwesenheit solcher grundlegenden Gespräche. Meinen Sie, ich hätte jemals mit meinem Vater, mit meiner Mutter, meiner Verwandtschaft über den Grund oder die Bedingung ihres Glaubens reden können? Das ist nicht der Fall. Der Glaube war in ihnen von Kind an gesetzt. Der Glaube maß sich daran ab, ob man in den Gottesdienst geht, wie man in der Gemeinde mitwirkt, ob man sich an gewisse Regeln hält und ob man betet. Niemandem von ihnen möchte ich einen persönlichen Bezug zu Gott absprechen, wer wäre ich denn? Aber mir fällt auf, dass dasselbe Material, aus dem meine Apfelweinbekanntschaft seinen Unglauben, seinen ungläubigen Zweifel an dem Zirkus ableitet, Zirkus ist es ja in seinen Augen – dass genau dieses Material bei der großen Gruppe der Brauchtumsgläubigen eben genau diesen Glauben ermöglicht. Sie finden zwar manches auch unsinnig, aber akzeptieren es mühelos, weil sie im Ritual aufgehoben sind und sie ihren Glauben lieben und wertschätzen und sich ohne ihn verlassen fühlen würden.
Schauen Sie zum Beispiel meinen Vater an: ein ehrenwerter, hilfsbereiter, wenn auch strategisch denkender Mensch, Jurist und, anders als Jesus Christus, mit allen weltlichen Wassern gewaschen, dazu dreißig Jahre im CDU-Vorstand im Kreistag meiner Heimatregion. Jeden Sonntag Gottesdienst, gern auch Gebete vor dem Essen, daneben größere Tagesphasen, wo sein Handeln sicherlich nicht von einem Gottesglauben beherrscht war, aber doch von einer ihm grundlegend innewohnenden Moralität. Er konnte zwar, wenn er für Leute etwas erreichen wollte, ganz schön die Wahrheit biegen, aber er war nun einmal Jurist und, wie gesagt, mit allen Wassern gewaschen. Manchmal zog ich ihn als Jugendlicher auf, als ich bereits in einigen entwickelten Gedanken drin war, die zwar noch nichts mit dem Wort „Gott“ zu tun hatten, aber immerhin schon mit einem gewissen Solipsismus, der bei mir die Vorstufe zur Öffnung zum Wort „Gott“ hin war. Aber zu meiner eigenen Entwicklung später. Also, ich zog ihn auf und fragte ihn einmal, als er einen Satz über das Leben nach dem Tod sagte, und zwar einfach so dahinsagte, ob er daran wirklich glaube. Er sagte: Was heißt hier glauben? Davon kannst du ausgehen! Ein Gespräch freilich war nicht möglich, ehrlich gesagt interessierte es ihn auch nicht sehr, er fühlte sich vielmehr ein bisschen bedroht dadurch. Ich gehörte für ihn ja zu denen, die alles zerredeten. Der Glaube war in ihm so gesetzt wie etwa die Liebe zu seiner eigenen Mutter, beides hatte auch etwas mit bloßem Gehorsam zu tun und damit, dass man sich durch Gehorsam gegenüber einer guten Sache wie Glaube und Mutter als guter Junge bzw. Mensch bzw. Mann zeigt.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, folgendes ist für mich etwas schmerzhaft einzugestehen, denn ich möchte meiner Familie und überhaupt den Mitgliedern dieser großen Gruppe von Brauchtumschristen nicht nahetreten, aber ich habe in meiner Verwandtschaft nur ein einziges Mal von einem Menschen ein wirkliches für mich glaubbares Glaubenszeugnis gehört, ein merklich persönlich relevantes Erlebnis mit dem Thema Gott und Glaube. Es war allerdings ein Erlebnis ex negativo. Aber hier und nur hier sah ich eine tatsächliche Verwebung eines Lebens mit dem Thema Gott und Glaube, wo ich bei den anderen sozusagen immer nur die Standards sah, die man früh erlernt und dann, als Christin oder Christ, entweder erfüllt oder, wie mein Apfelweinkollege, nicht erfüllt, weil man sie ablehnt, wie gesehen aus für ihn guten Gründen.
Halt und Gerüst
Noch ein kurzer Schwenk zurück zu meinem Vater und dem Apfelweintrinker. Ich halte es für absolut wahr, dass der christliche Glaube, wie er auch immer im Bewusstsein meines Vaters aussehen mag oder mochte, ihm Halt und Gerüst gegeben hat, und dass er aus ihm eine Lebenshaltung gezogen hat, die dazu führte, dass er alles andere als ein schlechter Mensch wurde. Ich halte es aber auch für ebenso wahr, dass auf genau dem entgegengesetzten Weg, nämlich durch eine aufrichtige Ablehnung von zirkushaften Dingen, die man ihm als Erlösungshorizont anbieten wollte, mein Apfelweinkollege zu genau demselben Ergebnis gekommen ist. Beide reden zwar völlig anders über den Glauben, aber beide sind sich doch auffällig ähnlich. Hilfsbereit, in Maßen kritisch, nie ideologisch verbiestert, koexistent mit anderen Ansichten. Brüder nicht in der Ansicht, aber in der Haltung.
Also zurück zu dem Erlebnis ex negativo, dieses hat etwas mit meiner Verwandtschaft im Osten und dem Zweiten Weltkrieg, näher gesagt mit dem Russlandfeldzug der Deutschen zu tun. Meine Tante Lenchen, eine Verwandte aus Sachsen, durfte, weil sie in der Bauernpartei war, recht früh reisen, ich lernte sie schon als Kind kennen. Wir verstanden uns gut, auch wenn sie sehr viel redete. Sie erzählte viel von ihrer Verwandtschaft. Nach 89, sie war sicherlich schon Ende siebzig, durften auch andere aus ihrem Umkreis reisen, und sie brachte einen Freund mit, den ich von Anfang an sachlich und sympathisch fand. Sie kannte ihn seit langen Jahrzehnten, beide hatten nun näher zusammengefunden. Er war bei Kriegsende über zwanzig, machte dann erst in der DDR seine Schule zu Ende und wurde noch während seiner Schulzeit, soweit ich mich erinnere, zum Lehrer ausgebildet. Deutsch war eines seiner Fächer. Von allen meinen Verwandten und ihrem Umkreis war er der Einzige, der über Kriegserlebnisse berichtete. In meiner eigenen Familie wurde nie vom Krieg berichtet. Es wurde auch nie darüber gesprochen, wer in der Partei gewesen war und wer nicht. Das war bei uns alles tabu.
Irgendwo in Russland, er ist bei der Artillerie, Winter. Die Armee ist bereits auf dem Rückmarsch und in schlimmem Zustand, ständige Todesangst. An welcher Stelle der Front sein Truppenteil gekämpft hatte, weiß ich nicht, aber die Entbehrungen müssen fürchterlich gewesen sein, und jetzt also die Russen im Nacken, während die Deutschen auf dem Rückzug oder der Flucht gen Westen sind. Unser Protagonist erzählte damals mit Fachwissen, er kannte natürlich die verschiedenen Kanonentypen und zu was sie dienten etc. Sie hatten, wenn ich es recht referiere, auch Luftabwehrgeschütze dabei.
Nun kommt das Religionserlebnis des armen Mannes in der russischen Weite in jenem Winter. Es geht einem Soldaten bekanntlich ums Überleben, aber hierbei ging es um etwas anderes, nämlich um die anderen, um Russen, die plötzlich zu Menschen wurden, und zwar im Augenblick ihrer Tötung. Er stand ihnen nicht einmal von Angesicht zu Angesicht gegenüber, nein, die Geschichte verlief so, dass ein anderer Soldat vielleicht sogar sehr glücklich gewesen wäre, denn der Tod des anderen bedeutet ja erstmal das eigene Überleben. Unser Mann im Osten überlebte diese Nacht, aber sie veränderte ihn. Sie stehen am Ufer eines Sees, der ihnen eigentlich den Rücken decken soll. Aber es ist eiskalt, der See ist zugefroren, er kann inzwischen massive Lasten tragen. Irgendwann in der Dunkelheit und der Stille der Nacht hören sie, ganz entfernt, leise, wie wispernd ein Geräusch. Es ist kaum zu vernehmen, nimmt aber zu, wird hörbarer, lauter, es handelt sich, wenn auch noch ganz fern, um Geschrei, Angriffsgeschrei. Angriffsgeschrei von Bodentruppen, die über den See jagen, in ihre Richtung.
Dauerfeuer, minutenlang
Hierauf geschah das, was unserem Protagonisten den Glauben, den Christenglauben an den Gott seiner Jugend und Kindheit und Erziehung, raubte. Seine Truppe vernimmt das Geschrei, und sie richten ihre Luftabwehrgeschütze, die, weil es sich um einen speziellen Typ handelt, auch in die Horizontale ausgerichtet werden können, ins Dunkle genau auf den See und beginnen zu schießen. Dauerfeuer, minutenlang. Mitten ins Schwarze, wo gar nichts zu sehen ist, nur eben das ankommende Geschrei zu hören war. Irgendwann hören die Luftabwehrgeschütze zu schießen auf. Anschließend ist nichts mehr zu hören. Völlige Stille, wie vorher. Nichts zu sehen, nichts zu hören.
In diesem Augenblick, so unser Protagonist, habe er den Glauben an Gott verloren. An einen Gott, der so etwas zulasse, konnte er von da an nicht mehr glauben. Er löste sich auf wie ein Wölkchen, dieser Gott. Das ist ein bemerkenswertes Erlebnis, denn von da an war dieser Mensch allein, ohne Gott, und lief so durch sein Leben, ganz anders als etwa meine Mutter oder mein Vater. Und wohlgemerkt hätte er ja auch glücklich und zufrieden sein können, weil ihm die Geschütze das temporäre Überleben gesichert hatten. Andere hätten vielleicht sogar Gott gedankt. Aber im Dauerfeuer der Kanonen hatte sich ihm alles aufgelöst, Freund, Feind, Gott und das Nichts. Es starben unsichtbare, ferne, anonyme Russen, es vergingen eigentlich nur Geräusche dort auf dem gefrorenen See. Sie erstarben durch die eigenen Geschütze. Das überforderte unseren Mann so, dass er fortan für jede Form von Gott oder Glaube unberührbar war. Ich habe das so ausführlich erzählt, weil es das größte, relevanteste und glaubhafteste Zeugnis über Gott und Glaube ist, wenn auch ex negativo, dem ich in meiner christlichen Verwandtschaft je begegnet bin.
Ich möchte auf eine weitere Gruppe zu sprechen kommen, nämlich Christinnen und Christen, die von ihrem Glauben keinerlei rhetorischen Aufhebens machen, sich fast dafür schämen und entschuldigen, in den Gottesdienst zu gehen, weil sie darin geradezu eine persönliche egoistische Anmaßung sehen, und sich ansonsten weniger um sich als vielmehr um andere kümmern, nicht im Sinne meines Vaters, der zuerst immer die Ökonomie im Sinn hatte und dann, nach Erwerb von Geld, Macht und Möglichkeit, diese teils sozial einsetzte. Die Leute, die ich meine, weisen natürlich die größte Christusnähe auf. Allerdings wirken sie oft ein wenig servil, als mangele es ihnen an Selbstwertgefühl. Aber warum nicht? Es sind die, bei denen der Glaube am wenigstens als Diskurs vorhanden ist und nicht einmal als Rechtfertigung dient.
Es gibt solche Leute auch bei den Ungläubigen. Diese sind den genannten Christinnen und Christen als Menschen wieder sehr verwandt von der Haltung her, und sie machen ebenso von sich keinerlei Aufhebens. Ich habe solche Menschen kennengelernt. Von außen betrachtet sind beide sogar einfach gleich. Und da sie nicht darüber reden, haben wir nun ein identifikatorisches Problem. Die einen sind Christen und die anderen keine Christen, und sie handeln beide gleich und geben uns keine Wortlaute, anhand derer wir ihren Glauben oder Unglauben ermessen könnten. Was bleibt denn dann für ein Differenzkriterium zwischen Glaube und Nichtglaube? Wäre die einzige Differenz dann nicht das explizite Glaubensbekenntnis? Ist das Glaubensbekenntnis, also eine Ansammlung von ausgesprochenen Worten, dann etwa das, das den fundamentalen Unterschied zwischen sonst überhaupt nicht fundamental unterschiedlichen Menschen ausmacht? Da sie aber damit nicht hausieren gehen, müsste man sie ja regelrecht zwingen, den Mund aufzumachen und zu bekennen. Aber das ist die seltsamste Vorstellung, die man haben kann. Stellen Sie sich Jesus Christus persönlich vor, mit all seinem Leben, seinen Taten, seinem Habitus, wie er vor jemandem steht und ihn auffordert: Los, bekenne oder bekenne nicht! Weise mir dein Glaubensbekenntnis vor, damit ich weiß, wer du bist!
Damit sind wir bei der letzten Gruppe meiner unvollständigen (Menschen wie meine Frau oder die mich zu diesem Vortrag einladenden Theologen kommen beispielsweise gar nicht vor), unzulänglichen und oberflächlichen Gruppenaufzählung, nämlich den Abgrenzungschristen. Abgrenzungschristen seien hier für den Moment als solche definiert, die sehr darauf achten, ob man das richtige Glaubensbekenntnis hat, und das kann nur heißen, dass man das richtige ausspricht. Denn ohne Aussprechen wüssten sie ja nicht, wen sie gerade vor sich haben, anders als Jesus Christus, dem war das völlig egal. Aussprechen führt für Abgrenzungschristen dazu, dass man zu der einen Gruppe dazugehört oder nicht dazugehört, und das ist für Abgrenzungschristen das vornehmlich Wichtige. Hier übrigens sollte ich tatsächlich geschlechterneutral formulieren, denn ich kenne mindestens ebenso viele Abgrenzungschristinnen wie Abgrenzungschristen.
Gruppenzugehörigkeit
Eine solche Abgrenzungsperson denkt in erster Linie in Gruppenzugehörigkeit, deshalb könnten wir ihr Verhalten vielleicht am besten so beschreiben, wie wenn wir über das Gruppen- und Revierverhalten gewisser Tiere sprechen würden. Als jemand, der 1967 geboren ist, bin ich ja noch mit den Erinnerungen an die alten Verwerfungen zwischen Katholischen und Protestantischen aufgewachsen. Zu meiner Lebenszeit waren diese Verwerfungen noch spürbar in den Erzählungen meiner Eltern und Großeltern. Seit damals haben wir übrigens einen Riesenfortschritt gemacht. Ich komme aus einer protestantischen Stadt, gehöre aber zu einer der wenigen katholischen Familien. Inmitten meiner Heimatstadt, Friedberg in der Wetterau, liegt eine gewaltige frühgotische Hallenkirche, gebaut lange vor dem Schisma. Zur Zeit meines Großvaters wurde noch gesagt, über die Schwelle dieser, inzwischen längst protestantisch genutzten, Kirche zu treten sei eine Todsünde für uns Katholiken.
Neulich hat ein Verwandter von mir geheiratet, eine katholisch-protestantische Mischehe. Auch das hatte noch etwas altmodisch-grabenkriegerisches. Die Katholiken steckten zusammen und tuschelten, wie sie das jetzt finden sollen, ob das die Protestanten an diesem Tag auch gemacht haben, weiß ich nicht, denn ich stand an dem Tag ja nolens volens auf der katholischen Seite und wurde selbst angetuschelt. Dass die möglichen Kinder katholisch erzogen werden sollten, war da das Mindeste, was die katholische Seite forderte. Ich kenne Menschen, für die ist der Protestant oder die Protestantin immer noch das erste Fremde in der Heimatwelt. Umgekehrt waren bei uns zu Hause wir immer in der Minderheit, das heißt, wir waren für die anderen, die Protestanten, die das ganze Stadtbild beherrschten, das erste Fremde. Eine Generation vorher hätte ich für meine Katholizität auf dem Schulhof noch aufs Maul gekriegt. Ich dagegen, als Kind, bekam auf der Schule nur noch deshalb aufs Maul, weil mein Vater bei der CDU, alle anderen aber bei der SPD waren.
Orientierungsrahmen
Abgrenzungschristen überprüfen die anderen auf die richtige Parteizugehörigkeit. Der Glaube ist zwar meist nicht sonderlich weit reflektiert, aber er ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ein theologisches Gespräch ist oft nicht möglich, es ist sogar unerwünscht, denn man macht sich verdächtig, wenn man analytisch über Glauben redet und ihn in etwas Fließendes, Modellierbares, Interpretatierbares und am Ende vielleicht sogar Moderierbares verwandelt. Das Weltbild des Abgrenzungschristen ist statisch und muss auch so sein, weil es sein Orientierungsrahmen ist. Ich möchte das überhaupt nicht lächerlich machen, auch wenn das Thema natürlich dazu angetan ist, denn alle handelsüblichen Klischees speisen sich von hier her. Etwa, dass man oder frau den oder die andere dahingehend überprüft, ob sie diesen Sonntag denn auch tatsächlich in den Gottesdienst gegangen ist, wie oft der oder die Betreffende überhaupt so in letzter Zeit in den Gottesdienst gegangen ist, warum man zu der und der Totengedenkmesse nicht erschienen ist. Das erlebe ich heute noch. Ich kenne kein Vereinsleben, bei dem man so streng beobachtet werden könnte.
Dem Abgrenzungschrist liefert seine Form von Glauben ein scharfes Instrument zur Sozialkontrolle, was umgekehrt bedeutet, dass er oder sie sich offenbar nur in einem stark sozialkontrollierten Umfeld wohl- und aufgehoben fühlt. Es ist für mich übrigens völlig unbezweifelbar, dass Abgrenzungschristinnen und -christen, für die ihr Glaube, wie gesagt, nichts Fließendes haben darf, sondern einfach ein für allemal gesetzt und durch Wortbekenntnis überprüfbar ist, die von offizieller kirchlicher Seite am meisten erwünschte Glaubensgruppe ist, und ich halte sie gemeinsam mit den Brauchtumchristen für die größte Gruppe. Brauchtum ist ja auch etwas, was Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit definiert, und im Ausüben des Brauchtums versichert man sich seiner eigenen sozialen Gruppe.
Hier gehen also Soziologie und Religion leider auf eine unauflösbare Weise ineinander. Leider, denn Glauben, der Umgang mit Gott, mit dem Wort Gott, mit einer so seltsamen Erscheinung wie Jesus Christus, Umgang mit Wörtern wie Heilserwartung, Wahrheit, Gutheit, Sünde, das ist schon ein mindestens philologisch schwieriger und interessanter Prozess, er kann zur inneren Gesprächsgrundlage für ein ganzes Leben werden. Aber man kann sich diese Worte und Dinge auch anziehen wie Kleidungsstücke, Hutfedern oder Gamsbärte und nach außen zeigen, um der Gruppe willen. Beides scheint sich mir eigentlich auszuschließen, und vielleicht liegt ja genau hier der Unterschied zwischen lebendigem und totem Wort, zwischen Wahrheit und Ideologie.
Brauchtumschristen und Abgrenzungschristen sind aber nicht unbedingt deckungsgleich. Mein Vater etwa hat zwar zeit seines Lebens eisern auf seinen Glauben geschworen, und er ist ein typischer Brauchtumschrist, aber sein Glaube hat ihm nie seinen psychologischen und emotionalen Haushalt ermöglichen oder regulieren müssen. Er neigt vor Protestanten nicht zum Tuscheln. Er hat sich in Zeiten seines Lebens teils auch dazu hinreißen lassen, über die oder den zu sagen, sie kämen nicht in den Gottesdienst. Aber er wollte da eher wie ein Generalsekretär die eigenen Reihen zusammen- und geschlossen halten. Das Spiel der anderen war für ihn das Spiel der anderen, das hat er immer respektiert, so wie er, als Politiker, ja auch immer das Dasein der anderen Parteien akzeptiert hat und wusste, dass sie genauso ihr Spiel spielen wie er das seine.
***
Und nun zu einem Versuch über meine eigene Sprachgenese. Ich selbst war von dem Brauchtumschristentum recht früh abgestoßen, da war ich noch ein Kind. Es quälte mich ehrlich gesagt. Ich fand so etwas wie die Person Jesus spektakulär, beneidenswert, heldisch, aber eher in Filmen oder Erzählungen. Die Gottesdienste machten mir jede Möglichkeit zur Anteilnahme zunichte, weil sie mich durch Langeweile in einer Weise folterten, wie ich es heute gar nicht mehr beschreiben kann. Die eine Stunde sonntags vormittags in der Kirche, öfter musste ich ja nie hin, war stets die schlimmste Stunde in der Woche. Übrigens musste ich wahrscheinlich auch deshalb mit, weil ich der Jüngste war und man zu Hause hätte eine Aufsicht für mich bereitstellen müssen, meistens in Form meiner Großmutter, die dann aus dem Nachbarort herbeigeschafft werden musste. Sie war bemerkenswerterweise protestantisch und hatte also sonntags morgens frei – sie ging selten in den Gottesdienst, glaube ich.
Der größte Held von allen
Von Jesus Christus ging natürlich, wie von jedem Helden, und er war, das wusste ich, der größte Held von allen, größer als Hektor, Odysseus, Parzival, Siegfried und Dietrich von Bern zusammen – von ihm ging ein Vorwurf, oder sagen wir lieber, eine permanente Demütigung aus, denn mir war völlig klar, dass ich sein Heldentum nie erreichen konnte. Die anderen, meine Eltern etwa, oder überhaupt alle Erwachsenen in der Kirche, hatten ein entspannteres Verhältnis zu ihm, der Lichtgestalt, was ich aber missinterpretierte. Ich dachte nämlich, sie seien nur deshalb entspannter, weil sie ihm näher seien, weil sie ihn besser verstünden, ihr Leben schon irgendwie auf dieses Heldenhafte ausgerichtet hätten. Als wären sie schon irgendwo, wo ich erst noch mühsam hinmüsste. Mit diesem Großen und Gewaltigen, Kreuzestod, sogar Wiederauferstehung, konnten sie irgendwie umgehen, nur ich konnte das nicht, schien mir. Das vergrößerte die Demütigung des Kindes. So kann ein Kindsgemüt auf Jesus Christus reagieren, wenn er ihm auf diese Weise von Eltern, Kirche, Umwelt und dem deutschen Fernsehen dargeboten wird. In ihre bürgerlichen Leben hatten sie tatsächlich diesen größten aller Helden integrieren können! Ich dagegen fiel völlig ab, kam mir vor.
Nun ereigneten sich einige Glücksfälle in meinem Leben, die dazu führten, dass ich nicht näher an das Christentum herangeführt wurde. Zum einen war ich als Kind völlig soziophob, die Grundschule war ein Martyrium, ich war am liebsten allein. Es kam nun aber auch noch der Erstkommunionsunterricht in Gruppenform auf mich zu. Das war für mich eine Horrorvorstellung. Ich fand schon das gemeinsame Beten abends beim Essen gruselig, die Menschen um mich herum fühlten sich währenddessen so seltsam an, wenn sie ihre Litanei beteten, als verwandelten sie sich für kurze Zeit in schlottrige Geister. Nun aber hatten wir einen Priester in Friedberg, der zugleich auch Lehrer meines fünf Jahre älteren Bruders war. Dieser Priester erwähnte einmal in der Klasse meines Bruders in einer Unterrichtseinheit das Wort „vorehelicher Geschlechtsverkehr“. Danach brach meine Mutter einen heiligen Krieg gegen ihn vom Zaun. Ergebnis: Ich wurde diesem Priester, wo es nur ging, ferngehalten, und durfte den Erstkommunionsunterricht bei ihm nicht besuchen. Ich durfte auch nicht zur Erstkommunion. Folglich war ich auch nie bei der Firmung. Bis heute bin ich nur getauft, und der Grund dafür ist die damalige katholische Sittenstrenge meiner Familie. Ich blieb also eine Zeit lang allem Kirchlichen fern.
Inzwischen ging ich bei meinem Bruder in die Schule, der sich unterdessen zu einem Marxisten und damit Materialisten erster Güte entwickelt hatte. Ich lernte von ihm zum ersten Mal so etwas wie analytisches oder dialektisches Denken, wenn natürlich auch nur in jugendlichen Maßen. Aber zumindest konnte ich mit diesem analytischen Werkzeug erstmals die Weltbilder meiner Eltern und von größeren Teilen meiner Umwelt durchdenken. Zum ersten Mal kam mir der Verdacht, dass vieles in meiner Umwelt nicht besonders weit reflektiert war. Gegen den Gottesbegriff der Glaubenden holte ich nun auch für kurze Zeit materialistische bzw. Feuerbachsche Argumente hervor.
Adressat des Todes
Allerdings entwickelte ich mich völlig anders als mein Bruder. Mein sehr gesellschaftsorientierter, politischer Bruder ist knallharter Materialist, allerdings auf nicht wirklich philosophisch sattelfeste Weise (aber wer wäre das schon?). Mein Bruder hält Gott für die Konstruktion der Menschen, die physische Realität für die einzige und ist auch dem ewigen populärmaterialistischen Vorurteil unterworfen, mit dem Tod sei alles vorbei. Ich möchte hier nur anmerken, dass sich mir da immer die Frage stellt, für wen denn im Tod alles vorbei sein soll? Soll für mich alles vorbei sein, wenn ich tot bin? Schon sind wir im performativen Selbstwiderspruch! Denn dieser Tod setzt mich ja voraus als Adressaten. Wenn alles vorbei ist, aber kein Ich dabei ist, für das es vorbei sei, dann haben wir ein viel ernsteres Problem, als es Leuten wie meinem Bruder bewusst ist. Er freilich hält das alles nur für Wortklauberei.
Mein vorläufiger, vom Bruder gestifteter Materialismus endete schon nach kurzer Zeit in einem massiven Solipsismus. Denn mir war klar, dass die materialistische Argumentationskette an einer Stelle hapert. Wenn ich die ganze Weise, wie Welt, Umwelt auf mich zukommt, auf meinen physisch vorhandenen sensualitischen Apparat reduziere, dann muss dennoch irgendwo die Stelle sein, wo plötzlich der Sprung irgendeiner Art von Außenwelt in mein Bewusstsein geschieht. Diesseits der Sprungstelle, auf der Seite meines Bewusstseins, kann ich mich meiner selbst durch Evidenz versichern. Ich bin ja. Aber ich kann mich nicht der Tatsache versichern, dass das, was sich auf der anderen Seite befindet, das ist, als was es mir erscheint. Ich kann mir also nicht einmal sicher sein, dass der ganze sensualistische Apparat, den ich voraussetze, also Augen, Nervenbahnen, Tastsinn, all das, was Schopenhauer in seiner Doktorarbeit so seltsam genau beschreibt, als könnte das helfen – ich kann mir nicht sicher sein, ob es das alles tatsächlich gibt oder selbst nur bloße Einbildung oder Täuschung ist. Deshalb lebte ich einige Jahre so, dass ich davon ausging, über nichts, was draußen ist, eine sichere Aussage machen zu können. Freilich lebte ich, aß, trank, verliebte mich, aber ich konnte daraus kein konsistentes Weltbild ableiten.
Deshalb interessierten mich auch die Argumente, mit denen Materialisten im Sinne meines Bruders klassischerweise Gottes Existenz ablehnen, überhaupt nicht mehr, weil Gott sich für mich von allen anderen möglichen Gegenständen dort draußen nicht unterschied. Seine Existenz war genauso prekär wie die des Bierglases, vor dem ich allabendlich saß. Ob Menschen Biergläser erfanden, oder ob sie Gottesbegriffe erfanden, war für mich völlig gleich, da ja die Menschen selbst nur eine unbewiesene Vermutung über die Außenwelt waren. Eigentlich war es damals eine gemütliche Zeit, obgleich sie natürlich dramatisch war, ich war ja dem kompletten Irrsinn nahe. Selbst wenn ich mit einem Mädchen schlief bzw. dieses mit mir, dann war es nur testweise, als hätte ich möglicherweise eine Fiktion vor mir oder einen Avatar.
Solipsismus
Anschließend setzte eine Phase ein, in der die Dinge komplizierter wurden oder werden mussten. Denn mein Solipsismus machte mir alles sehr einfach, er schaltete einfach alles gleich. Das machte ihn mir verdächtig. Ich begann Philosophie zu studieren. Mein Lehrer, Karl-Otto Apel, der leider gerade verstorben ist, beschäftigte sich mit genau diesen Grundproblemen, oder besser gesagt: Ich wählte ihn zu meinem Lehrer, weil er genau diese Probleme Ich, Außenwelt, Zweifel aufgriff. Stark war etwa das Argument des paper doubts, dass er gegen Descartes hervorbrachte. Wenn ich unterschiedslos alles auf dieselbe Weise anzweifle, wird der Zweifel zu einem Nullsummenspiel. Dann habe ich an den einzelnen Gegenständen und ihren Zusammenhängen nichts verändert und kann den Zweifel wie aus einem Bruch herauskürzen. Der Zweifel ist dann von einer redundanten Behauptung nicht zu unterscheiden.
Ein beliebtes Argument, oder ein rhetorischer Kniff Apels war, uns Zuhörerinnen und Zuhörer ganz tief in den Descartschen Zweifel hineinzuführen, in den Zweifel an allem, an der gesamten Außenwelt, um uns anschließend wieder aufzuwecken mit dem Hinweis, dass wir alle nun nach dem Seminar völlig zweifellos zur U-Bahn gehen und zweifellos erwarten, dass dann auch eine U-Bahn komme. Natürlich läuft das auf eine common-sense-Haltung hinaus. Ich kann zwar nicht beweisen, dass es U-Bahnen überhaupt gibt, aber wenn ich mich der landläufigen Meinung füge, ist zumindest ein Leben und ein Umgang mit Welt und eine U-Bahn-Beförderung möglich. Und da ich nicht schaffte, nicht zur U-Bahn zu gehen, und da ich auch nicht mit Essen und Trinken und mich Verlieben und allem weiterem aufhörte, begann ich, so etwas wie Umwelt und dass sie tatsächlich irgendwie in mich hineinragt, zu akzeptieren. Also dass mir da etwas gegenübersteht, in dem ich mich bewege und demgegenüber ich mich je so oder so positioniere. Und dass ich das nicht so einfach übergehen kann, indem ich theoretisch, durch solipsistischen Zweifel, alles gleichmache. Denn unzweifelhaft agierte ich ja z. B. unterschiedlichen Menschen gegenüber völlig unterschiedlich. Verstehen Sie mich recht, ich suchte nicht nach philosophisch relevanten Erklärungen, warum ich mich in der einen Situation so und einem anderen Menschen gegenüber so verhielt. Ich hielt nur zum ersten Mal die Tatsache fest, dass ich es tue und dass dieses unterschiedliche Agieren draußen, in der Umwelt, einen ungleich viel größeren Teil meiner Tage und meines Lebens ausmachte als meine wenigen Solipsismussätze, die ich dauernd aufreihen konnte und die verlockend logisch klangen, aber eben fast alles außer Acht ließen.
Ohne es zu merken, denn ich sprach ja damals nicht von Gott, sondern studierte Philosophie, nahm ich den lieben Gott die ganze Wittgensteinsche Leiter mit nach oben. Ich beschäftigte mich mit Fragestellungen wie Konzeption von Identität, Konzeption von Wahrnehmung, mit der Frage, ob ich tatsächlich unhintergehbar von einem Wahrheitsanspruch ausgehe, wenn ich überhaupt nur den Mund aufmache. Oder mit der Frage, wie sich die Dingwelt zur Sprache verhält bzw. umgekehrt, oder ob die Dichotomie Dingwelt versus Sprache überhaupt sinnvoll ist oder nicht. Kurz, alles traditionelle philosophische Fragestellungen.
Im Nachhinein nenne ich diese Zeit meines Studiums die Zeit der Umwege. Ich wurde als Mensch differenzierter, verästelter, lernte verschiedene Standpunkte kennen, geriet mit Kant genau in die Schnittstelle zwischen Idealismus und Materialismus und hatte vielfältige Theoriebildungen im Kopf, die ich stets hemmungslos auf mein Alltagsleben anwendete. Vieles davon habe ich inzwischen wieder vergessen, weil ich an einem Punkt plötzlich ganz naiv zu werden begann.
Gott oder Apel
Ich begann testweise das Wort Gott zu verwenden. Ich hatte das Wort noch nie verwendet. Ich verwendete es nicht im spirituellen Sinn. Nicht aus sentimentalen Gründen. Nicht aufgrund eines konkreten spirituellen Erlebnisses, obwohl ich inzwischen weiß, dass ich vieles, was ich früher erlebt habe, mit Spiritualität zu tun hat, aber avant la lettre, ich hätte es damals nie so genannt. Sondern ich verwendete das Wort Gott, um zu erfahren, welche Aussagen mit diesem Wort möglich sind und welche nicht. Und je mehr ich das Wort austestete, desto mehr kam mir vor, dass tatsächlich meine vorherigen Denkwege immer Umwege gewesen waren. Denn ich hatte durch vielfältige Theoriebildung immer Dinge zu beantworten versucht, die ganz einfach zu beantworten sind, wenn man das Wort Gott verwendet. Woher ich etwa diesen Wahrheitsanspruch hatte, das kann man entweder mit Karl-Otto Apel formulieren, dann muss man sich eines Postulats bedienen, dessen Notwendigkeit oder Unhintergehbarkeit man erst einmal theoretisch begründen muss. Immer, wenn ich meinem Bruder Apel erklärte, hielt er all das für bloße Wortklauberei. Oder ich verweise auf meine Herkunft von Gott her, und alles ist ganz einfach zu sagen. Verstehen Sie mich recht, ich meine das nicht biologistisch oder physisch oder gar metaphysisch, dass mir etwas eingepflanzt sei, was ich wissenschaftlich doch irgendwie isolieren und zur Anschauung bringen könnte. Nein, es ergibt sich ganz allein aus dem Begriff Gott, es gehört zur Verwendung dieses Begriffs. Gott beinhaltet, dass ich sein Geschöpf bin. Geschöpfsein heißt, von ihm her auf ihn hin geschaffen zu sein. Das ergibt sich ganz allein aus dem Begriff. Wenn ich das meinem Bruder sagte, hielt er mich für komplett verrückt geworden.
Ich fand faszinierend, wie viel diesem Wort möglich war, und ich verstand immer weniger, wieso es so stigmatisiert war und unbedingt ausgeklammert gehören sollte. Ich weiß, das klingt etwas blutarm, aber anders kann ich es nicht sagen und meine offenbar theoretisch vorbereitete Naivität auch nicht anders beschreiben (allerdings habe ich sie an anderer Stelle vor einigen Jahren ausführlicher dargelegt, ohne das jetzt hier wiederholen zu können). Mit der Verwendung des Wortes Gott war plötzlich vieles möglich. Zum Beispiel meine seltsame Zwiegespaltenheit wurde erklärbar, also dass ich einerseits evidentermaßen ein eigenverantwortliches Subjekt bin, sogar eines, das sich von den anderen dadurch unterscheidet, dass für es durch es die ganze Welt mittransportiert wird. Und dass ich andererseits für mich ebenso evidentermaßen soweit unverfügbar bin, dass sich vieles an mir völlig meiner Kontrolle entzieht. Diese Dichotomie könnte nicht besser aufgelöst werden als in meiner Verortung als Geschöpf im trinitarischen Prozess. Geschaffen bin ich aus Liebe, aber ich musste zu etwas geschaffen werden, damit ich Empfänger dieser Liebe sein kann. Deshalb muss ich ich selbst sein können, und deshalb muss ich zugleich unvollständig sein, denn erst in Gott, in seiner Liebe, wenn ich von ihr erfüllt bin und sie endlich widerstandslos an alles um mich herum weitergebe, kann ich mich selbst wirklich finden etc. Das klingt kitschig, aber anders sind die Begriffe, die sich aus Gott ergeben, nicht formulierbar.
Trinität ist natürlich eine sehr philosophische Konstruktion, das kann man so sehen. Aber ich halte sie zugleich für eine Begriffsexplikation des Wortes Gott. Ich bin in ein Verhältnis gesetzt, das bedingt das Wort Gott. Und indem ich so spreche, rede ich weder physikalisch-biologisch-materialistisch noch metaphysisch. Ich stelle mir, indem ich das Wort verwende, ja nicht einmal die Frage, ob ich an Gott glaube oder nicht bzw. ob ich ihm eine Existenz zugestehe oder nicht. Die Frage stellt sich bei diesem Wort für mich nicht. Sie stellt sich für mich auch nicht bei den Worten Liebe, Hass etc.
Ich bin natürlich dennoch sehr glücklich über den schließlich von Feuerbach eingeleiteten Tod Gottes, denn er hat den Begriff befreit. Die Lebenslast dessen, was Kirche und praktischer Glaubensvollzug dem Begriff aufgebürdet haben, konnte von ihm abfallen. Menschen wie ich konnten erst einmal lange Zeit außerhalb des Begriffs, ohne seine Benutzung leben. Aber bei allen philosophischen Fragestellungen, mit denen ich die Leiter hinaufkletterte, hatte ich Gott immer im Gepäck, ohne es zu wissen. Denn alles wäre auch schon vorher in eine Sprache übersetzbar gewesen, in der das Wort Gott vorkommt. Meine Sprache zur Universitätszeit, und ich glaube, ein Großteil unserer Sprache seit Längerem kommt daher, dass wir das Wort peinlich genau ausschließen wollen. So sind wir alle immer auf Umwegen. Ich halte diese Umwege für äußert produktiv. Letzten Endes können sie irgendwann dienen für die Wiederinstallierung des Wortes Gott in unsere allgemeine Sprachwelt.
Ich nannte diesen Vortrag „Und Gott fiel die Leiter herab.“ Das muss ich noch ausführen. Denn bislang habe ich ihn ja nur die Leiter hinauf mitgenommen.
Kein Wortlaut, kein Bekenntnis
Religion, Spiritualität, Glaube muss ich jeden Tag neu erringen in einem hermeneutischen Prozess, den ich aber bitte mit mir selber führe. Religion muss ich in mir erringen, sicher nicht draußen in der Umwelt. Jesus war kein Abgrenzer und kein Parteigänger und kein Wortlautüberprüfer. Jesus war ein Mensch, der keine Wortlaute und keine Bekenntnisse brauchte. Er brauchte nur Gott bzw. Wahrheit bzw. Liebe. Wenn ich glauben will, dann richte ich die Aufgabe an mich, nicht nach draußen an andere. Und wenn wer auf mich zukommt und mich überprüfen will, ob ich zu einem rechten Glauben gehöre oder nicht, dann wende ich mich unauffällig ab, entgleite der Situation. Gehen Sie in einem solchen Fall lieber spazieren. Und werden Sie niemals, niemals, niemals zu einem Parteigänger und werden Sie niemals zu einem Eiferer. Dann wird der liebe Gott, glaube ich, Sie segnen, so wie ich Gott durch das Wort Gott verstehe.
Für mich ist die Rede von und mit Gott heutzutage etwas, was vieles viel leichter sagbar macht, als wenn man bloß in Philosophie gefangen bleibt. Philosophie ist eigentlich genau das Gleiche wie Theologie, nur dass eben ein Wort nicht verwendet werden darf. Umgekehrt ist Theologie, so wie ich sie kennengelernt habe, nicht minder intelligent als Philosophie. Der Unterschied ist eben die Benutzung oder Thematisierung des einen Wortes. Im Rahmen der Ideengeschichte des westlichen Abendlands halte ich die Ausformulierung des trinitarischen Modells für die allergrößte Leistung. Da kann natürlich nur jemand mitgehen, der das Wort zu benutzen gewillt ist, das Wort Gott.
Aber ich glaube zugleich auch nicht, dass das Wort so elaboriert werden muss, wie ich es für mich ständig tue. Das meine ich mit dem Herabfallen Gottes von der Leiter. Gott ist mir zwar in meinem seltsamen intellektuellen und dann wieder naiven, zerfetzenden und dann wieder simplifizierenden Lebensweg gefolgt, zuerst in nuce, dann offenbar, aber das ist eben nur mein Lebensweg. Er hat es geschafft, all diese Stufen mit mir hinaufzuklettern, aber kaum war er oben, und mit oben meine ich keine Bewertung, keinen Siegerpreis … kaum war ich dort angekommen mit seiner Begleitung, habe ich ja selbst gemerkt, dass ich auch schon auf allen Stufen vorher das Wort hätte benutzen können. Er fällt mühelos auf jede weitere Stufe zurück. Und auch wieder ganz herunter. Ohne diesen Gedanken ist Gott völlig sinnlos. Er erfordert keine Intellektualität und kein Philosophiestudium. Gott wählt nicht aus. Er bevorzugt nicht. Er hat auch mit dem Wort Abgrenzung sicher nichts zu tun. Er lässt uns machen, und es gibt tausend verschiedene Wege zu ihm, eingeschlossen den einfachsten. Wer oder welche aber nicht zu denen gehört, denen der einfachste Weg zugestanden ist, wer also Worte braucht, sollte Komplexität anstreben und sich in den Diskurs begeben. Denn nur so werden wir unser eigenes Wort lebendig erhalten können. Das lebendige Wort ist nicht gefährlich. Gefährlich ist das tote Wort.